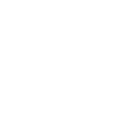Zur Person Erich Leitner
Leitner Erich ist gebürtiger Marienfelder und seit einigen Jahren im Ruhestand. Er studierte Produktionstechnik und Betriebswirtschaftslehre in West-Berlin. Mit Arbeitern über Industriegüter-Marketing wurde er diplomiert. Er arbeitete sein ganzes Berufsleben im Osteuropa-Geschäft. Zu Beginn im Angestelltenverhältnis, danach viele Jahre selbständig mit eigenem Unternehmen bis zur Altersgrenze.
E-Mail: leitner.erich@gmx.de
Impressionen von Marienfeld, bei einem Besuch 2016, von Erich Leitner
Von Erich Leitner geschrieben der die Heimat besuchte.
Der Plan, Marienfeld mit einem Besuch zu ehren, entsprang nicht einem irgendwie empfundenen Heimweh. War eher Doppelergebnis von stiller Neugier und Bedenken, eine womöglich letzte Besuchsmöglichkeit zu verpassen, wenn eine Reise ohnehin durch das Banat führt.
Auf dem Weg von Canad nach Nero war der Weg nach Groß-Sankt-Nikolaus nicht gleich zu finden. Die Straßen sind besser als früher. Und schnell von Nero kommend zeugte der Sportplatz von der Ankunft im Ort Marienfeld. Trotz Sonnenscheins und eines herrlichen Herbsttages war die Empfindung untröstlich. Bewohnte Häuser, Dächer, Fassaden, verlassene Häuser, teils verschwundene Gebäude, Flächen zwischen Gehwegen und Straßen, sind nur unangenehme Anblicke. Viele Häuser stehen da ohne Putz an Front-und Rückwänden.
Wenig Menschen waren an einem Arbeitstag auf den Straßen zu sehen, gegenüber dem Gemeindehaus standen Leute, die sicher keiner Arbeit nach gehen, nicht auf Besucher warteten und eifrig mit dem Dorfpolizisten plauderten. Vor der Ex-Klosterschule fragte ein Mann, wen wir suchten, ob wir Hilfe bräuchten. Nein danke, keine Hilfe nötig.
Nach 55 Jahren Abwesenheit war es sehr schwierig, Häuser den Ex-Bewohnern zu zuordnen. Es gibt keine artesischen Brunnen mehr, teils auch keine Spuren der ehemaligen Brunnen in der Mokriner Straße. Mit Mühe war das Geburtshaus, das Haus der verbrachten Kindheit, zu erkennen. Da es wuchtig umgebaut worden war. Die Häuser erscheinen heute klein, nieder, geduckt, wie von Elend gebeugt. Als knieten diese. Vor langer Zeit wohnten fleißige und stolze Menschen dort. Es war bescheiden, geordnet, der Arbeitsgegenstand der Bewohner waren Rebenpflanzen und Weinproduktion. Arbeit ohne Ende für alle.
Die Erstansiedler kamen 1769, viele in 1770, und in 1771 waren alle Häuser belegt. In den ersten Dekaden nach der Ansiedlung ist über den Weinbau wenig überliefert. Unter den Siedlern waren viele, die sich in ihrer alten Heimat mit Weinbau beschäftigten. Die Menschen brachten ein spezifisches Know-how mit in den Ort, entwickelten dieses weiter, passten Rebsorten und Arbeitsverfahren dem Boden und Klima an. Der Ort wuchs, zog Menschen an. Bei Ausbruch des 2. Weltkrieges wohnten 3200 in Marienfeld.
Dann gingen sie fort. Wissen, Fleiß, Ordnungssinn, Disziplin nahmen sie mit ihrem Grundcharakter mit. Andere kamen. Dieser Bevölkerungstausch ist ein Unfall der Geschichte, aber ein solcher wie mit Fahrerflucht für den Ort. Im Herbst 2014 wurden die letzten Rebstöcke entfernt. Diesem traurigen Ereignis widmete gerade ein rumänischer Agraringenieur einen emotionalen Bericht. Jetzt scheint es im Ort keine Arbeit zu geben, keine Dauerläuferbrunnen, keine Rebstöcke, keine Trauben, keine Fässer und kein Wein. Es gibt keine Fertigkeiten mehr, durch Weinbau die Erlöse pro Hektar zu mehren. Der Weinbau war arbeitsintensiv und band viele Arbeitskräfte.
Der Ort ist jetzt zu groß, hat zu viele Häuser und beherbergt zu viele Menschen. Bei enorm gestiegener Produktivität sind für die riesigen vom Weinbau befreiten Agrarflächen wenige Arbeitskräfte nötig. Und stattliche Traktoren, geeignet für eine mechanisierte Landwirtschaft, waren zu besichtigen. Rückbau wäre angesagt. Es kann kaum genug Geld geben, Häuser und Infrastruktur zu sanieren und zu erhalten. Als Museum im Verfall wäre der Ort ungeeignet.
Den Nachbewohnern wurde der Ort geschenkt. Doch diese Jetztmenschen lassen den geschenkten Ort verkommen. Sie nicht, die nun fort sind, hatten sich Jahrhunderte angestrengt. Der Park allein spiegelt die Misere. Übrigens der sich im Park verirrte russische Soldat ruht immer noch in seinem Parkgrab.
Das Kirchdach schien abgedichtet zu sein. Doch der Eingang vom Kirchgarten zur Sakristei ist zugemauert. Ministranten gingen früher die Treppe runter in den Garten, um den Weihrauchkessel zu befeuern. Die Fassade, Gartenseite, der Kirche sieht schlimm aus. Der Anblick des Pfarrhauses samt Garten stimmt traurig. Würde der Gemeindepfarrer Adam Zens heute seinen Garten sehen, er würde wohl kaum nüchtern dieses Chaos ertragen können. Ja früher, gab es im Kirchgarten Aprikosen, wohlschmeckend, da der liebe Gott deren Gedeihen begünstigte. Und derselbe Gott drückte beide Augen zu, wenn wir Kinder einige aus dem Garten stahlen.
Im Friedhof wohnen nur frühere anständige Menschen. Mauern, Gräber, Grüften, Kreuze u. a. sind jetzt verrutscht, verschoben, ähnlich nach einem Erdbeben. Da die Erdbeben in den letzten 50 Jahren nicht die Schäden verursacht haben können, wäre eine Erklärung, dass die Toten, allein und verlassen geblieben, die Friedhofsordnung selbst stören. Es ist kaum zu beschreiben. Die Menschen gingen fort und ließen ihre Toten zurück. Und weil man überall in Friedhöfen bezüglich der lebenden Angehörigen Schlüsse ziehen kann, fällt der Schluss nicht günstig aus. Die Toten haben es nicht verdient, in einem Ruinenfriedhof zu liegen, schließlich haben einst die Angehörigen deren Tod beweint und betrauert. Nun sind die Toten in ungepflegten Gräbern sich selbst überlassen, allein geblieben. Und haben keine Hoffnung auf ein Ende des Zustands, viele ohne Hoffnung auf Besuch ihrer Angehörigen. Es wäre besser, die ungepflegten Gräber aufzulösen.
Erich Leitner
Gedanken über Marienfelder Mütter
Vor einiger Zeit teilte ich Ausgewählten mit, dass es meiner Mutter nicht (mehr) gut ginge. Eine Verschlechterung in Eile. Darauf erhielt ich feinfühlige Bekundungen des Verständnisses, die mich bewegten und gedanklich beschäftigten. So schrieb Helga, sie könne mich gut verstehen, die Mutter leiden zu sehen, nicht helfen zu können, geplagt von einem schlechten Gewissen, vielleicht doch nicht alles getan zu haben. Helen fragte, welche therapeutischen Möglichkeiten es noch gebe, um das Leiden zu lindern? Gertrud schrieb wie oft sie fuhr, ihre Mutter zu besuchen, ging besorgt, auch mit schlechtem Gewissen, nicht länger geblieben zu sein. Gabi schrieb, es soll ihr doch gut gehen, sie soll so willen stark bleiben. Herta meldete sich und wünschte Kraft, die notwendig sei, das durch zu stehen, sie hätte solches schon hinter sich. Franz sagte einmal, frage deine Mutter bevor es zu spät ist, er hätte es sehr bedauert seiner Mutter viele Fragen nicht gestellt zu haben. Stefan rief an, sagte, ich solle bedenken, dass von unserem Jahrgang außer mir niemand mehr eine Mutter habe. All das und anderes mehr ließ den Entschluss reifen darüber zu schreiben, jetzt, über die Mütter in unterschiedlichen Ausprägungen und aus verschiedenen Blickwinkeln.
Mein Opa flehte gelegentlich in verzweifelten Momenten, gegen den Himmel gerichtet, rief, Mutter warum hast du mich so früh allein gelassen. Seine Mutter starb als er ungefähr sieben Jahre alt war. Er wuchs wohl in einer gedrückten Stimmung bei einer Tante auf, vielleicht mit Eigenschaften einer Stiefmutter, oder er zumindest die wahre Mutterliebe vermisste. Übrigens im Ungarischen wird der Mutter noch „süße" vorangestellt, also süße Mutter. Bevor Kinder Mutter sagen können sagen sie Mama, Mam-ma, Mam-ma, in Text und Wort können die unterschiedlichen Gefühlsvarianten nicht gut ausgedrückt werden. Aber in Sprache und Gesang können Emotionen rührend übertragen werden: Maa-maa, Heintje, vielleicht vor vierzig Jahren, sang das Lied bis zur Tränenrührung. Ebenso sangen alle Tenöre der Welt das italienische Volkslied Maaa-ma. Die Tochter meines Cousins sang es am Geburtstag ihrer Mutter.
Eminescu setzte mit dem Gedicht „O Mama", seiner Mutter ein Denkmal. Er trauerte mehr um seine Mutter, als nach dem Tod seines Vaters. Das Originalgedicht ist ein Kunstwerk in drei möglichen Varianten über den Tod seiner Mutter, über den seinen vor dem Ableben seiner Mutter und über ein Sterben zusammen mit ihr. Die Übersetzung, eigentlich mehr Nachdichtung, doch ausgezeichnet auch diese, lautet auszugsweise: „Oh, Mutter, liebste Mutter, aus Nebeldunkelheit … rufst mich in deine Ewigkeit; … Zweige rauschen … als sprächen sie dein Wort … Sie werden ewig rauschen, du ewig ruhest dort."
Ein anderer großer Rumäne kommt hier nicht gut weg. Pacepa, ex-Geheimdienstchef von Ceausescu, nach seiner Flucht in die USA schrieb 1988 in dem Buch „Rote Horizonte", dass die Mutter Ceausescus nachmittags bis abends im großen Hof saß, um ihren Sohn nach dessen Feierabend wenigstens zu sehen. Sie sah ihn, doch er grüßte sie nicht immer, ging mit anderen an ihr auf der Bank sitzend vorbei, schenkte ihr keine Aufmerksamkeit.
Die Kaiserin Maria Theresia wurde vor 300 Jahren 16fache Mutter, verteilte ihre Liebe auf ein Dutzend überlebende Kinder. Die heutige Königin von Europa mit DDR-Vergangenheit ist keine Mutter geworden. Die Mutter der fünf Söhne von Amschel Meier, später als Bankerfamilie Rothschild bekannt geworden, verabredete angeblich mit ihren Söhnen, durch Darlehen keine Kriege mehr zu finanzieren. Friede kehrte ein, das bewirkte eine seinerzeit einfache Vielfachmutter. Napoleon musste angeblich aufhören Kriege zu führen, weil die Mütter in einen Geburtenstreik traten und es als Folge zu einem Mangel an Soldaten kam.
Maria ist im christlichen Glauben die berühmteste Mutter: Heilige Maria, Mutter Gottes, wurde von Gott ausgewählt und unter allen Menschen ausgezeichnet. Es gibt keine vergleichbare Mutter, eine solche Ehre wurde nicht einmal den Engeln zuteil.
Ja, eine Mutter ist für immer und ewig eine Mutter. Und ihr Kind ist für immer und ewig ihr Kind. Das ist das Schicksal der Mutter und des Kindes.
Interessant ist, Mutter heißt das Maschinenelement, das zu der Schraube passt. Die Logik versagt jedoch, das Paar der Mutter in der Technik ist nicht der Vater, sondern die Schraube. Ohne Muttern, Plural der Technikmutter, gibt es keine Technikprodukte. Also hat die Mutter im Leben eines jeden Menschen und in der Technik überragende Bedeutung. Unseren Lebensraum verdanken wir übrigens der Mutter Erde.
Mütter können komplizierte Arten von Schmerzen, und Abwesenheit von solchen, durchleben, wenn sie altern. Und alles Leben ist doch die Vorstufe des Alters. Ja, eine Mutter hat man nur einmal. Meine Mutter war die erste Mutter in meinem Leben, ich konnte zu Recht glauben, dass Mütter so sind. Sie sind so, dass wir sie Mama rufen. Die Mütter beschäftigen sich immer mit uns, mit ihren Kindern. Sie achten auf ihre Kinder, sind glücklich wenn es ihnen gut geht. Wenn sich Erfolg nicht einstellen will, niemand das Bemühen des Kindes positiv beurteilt, die Mutter findet wirkungsvolle und tröstliche Worte.
Mütter können leiden, in Traurigkeit, den ständigen, unversiegbaren Schmerz ertragen. Mütter können Kinder trösten, diesen erklären, dass man weder die Welt als Ganzes, noch eine Teilmenge von dieser in Besitz nehmen kann, dass man mit Winzigem auch glücklich leben kann, sie können die Welt hinreichend erklären, dass man überzeugt wird, mit wenig Üppigem zufrieden zu leben. Sie können Kinder überzeugen, dass jeder mit ihr verglichen langsamer ist als sie.
Die Haarfarbe meiner Mutter wurde nicht früh grau. Andere Frauen hatten Angst vor dem Grauwerden. Sie ließ später silberne Strähnen auf ihrem Kopf zu. Das machte sie nicht älter, nur würdevoller. Ob nun jünger oder später ergraut, die Würde prägt die Erscheinung. Ja die Würde hat sie geprägt, die Fröhlichkeit hatte sie längst eingebüßt. Sie konnte eher traurig sprechen und heiter schweigen. Man kann mit ihr über den Alltag, die Finessen des Kochens, über Politik, über Türkenkriege und über das Kastensystem ihres Geburtsortes sprechen. Reiche Bauern gab es, dann die Mittelschicht der Handwerker und Händler und die dritte Schicht, für die es angeblich in Zügen die 3. Klasse gab. Das waren Taglöhner, Knechte und Mägde. Sie ist jedenfalls außerstande eine Frage nicht zu beantworten. Eine Frage muss beantwortet werden auch "ich weiß nicht" ist eine Antwort. Oder mit einer Gegenfrage.
Später werden Mütter real doch langsamer, die Gedanken schweifen umher, essen weniger und beginnen aktiv Erinnerungen zu vererben, wollen Erlebtes der Nachwelt weitergeben. Das geschieht oft in Wiederholungsschleifen, betonen die nötige Achtsamkeit, um durch Aktion oder Unterlassen im Leben keinen Schaden zu nehmen. Ginge dies, dann würden Mütter die Umgebung so beeinflussen, dass ihre Kinder auch nach ihrem Tod geschützt sind. Mütter wären ideale Schutzengel, hätten sie nur ewige Flügelschläge.
Das entstandene Elend für Familien und Kinder wurde nicht ausreichend thematisiert, als nach dem letzten Krieg viele Väter nicht mehr zu ihren Kindern zurückkehrten, entweder weil sie gefallen, vermisst oder in Deutschland, USA, Argentinien oder Australien weiter lebten. Es waren zu viele Rumpffamilien, in denen die Mütter nimmermüde schufteten, die Kinder mit den Großeltern durch zu bringen. Manche hatten sogar Hunger gelitten. Meine Mutter hielt die Erinnerung an den Vater wach, zeigte Fotos und beschrieb ihn als Mann mit achtenswerten Eigenschaften. Doch als nach 18 Jahren Trennung das Treffen im Lager nahte, war die Mutter nicht mehr sicher, ob der Vater dem gezeichneten Bild noch entsprach. Doch mein Vater war ein anständiger Mann, verstarb schon vor 32 Jahren. Obwohl verheiratet mit meinem Vater, später verwitwet, lebt meine Mutter schon 50 Jahre ohne ihn, entwickelte Energien wie zwei Mütter, wenn schon nicht wie Frau und Mann zusammen.
Den Müttern, die in Marienfeld ihre Kinder als quasi Halbweisen aufgezogen haben sollte man ein Denkmal im Ort errichten. Ähnlich der Dreifaltigkeit im Park aber mit Abbildungen jeder Heldin. Zeichen, ob diese Mütter sich für ein, zwei oder gar drei Kinder aufopferten dürfen nicht fehlen. Sie hatten unglaubliche Schicksale durchlebt. Es wuchsen sogar Kinder auf, deren Väter nicht mehr heimkehrten und deren Mütter in die Sowjetunion verschleppt wurden. Das war die unübertroffene Steigerung von Langzeitschmerz. Da kam die Frage auf, warum der Herrgott das zuließ? Weil er das nicht verhindert hatte, reicht es, ihn nur Gott, ohne Herr zu rufen, also die kargere Bezeichnung zu benutzen.
Die Mütter machten „Karriere" in dem landwirtschaftlichen Staatsgut und im Kollektiv und begannen mit ansteigenden Anstrengungen den Sozialismus aufzubauen. Als dieses sozialistische System begriff, sich eingestand, dass es Geld gibt, dass Geld als solches existiert, da nahm es zögernd zur Kenntnis, dass es das außerhalb der engen Welt gab. Ob so dennoch ein Leben möglich war, wurde vieldeutig verschwiegen. In einer Diktatur können die einfachsten Dinge kompliziert sein und komplexe Probleme unlösbar. Die Lage war bedrückend und dass die Partei freiwillig Grundlegendes änderte, oder später nach dem Einsturz des Kommunismus, die Lebensverhältnisse sich merkbar änderten dafür gab es keine Hoffnung. Deshalb der Wegzug in eine andere Welt, aller, auch der Heldinnen, die Mütter. Mit nur tragbarem Hab und Gut. Sie gingen wie sie kamen. Das Dorf den Neubewohnern, mit allem in 300 Jahren Erarbeitetem, geschenkt. Die Mütter setzten es in der neuen Welt fort Mütter zu sein. Rastlos, zielstrebig, achtsam und nimmermüde.
Erich Leitner
Augsburg den 27.01.17
„Weingärten in Portugal, erinnern an die alte Heimat Marienfeld“
Ich war einige Tage in Portugal, sah dort Weinreben, Trauben, auch Sorten die wir kannten, und, ich dachte an Marienfeld. Diese Erinnerungen nehmen wir mit, wenn wir gehen. Weiter vererben können wir diese nicht. Nicht mehr. Nicht einmal auffrischen lassen sich die Erinnerungen. Weil, ja weil, es keine anzuschauenden Reben mehr gibt. Jetzt, wo die Reben dort nicht mehr sind, jetzt, stelle ich fest, dass unsere Vorfahren diese dorthin mitnahmen, oder sie dann dorthin holten. Als wir Kinder waren, waren die Reben überall, als hätte der liebe Gott die Gegend mit Reben geschmückt. Als hätte es sonst keinen Platz mehr gegeben die Reben in der Landschaft unterzubringen. Im Herbst roch es nach Mostmantsche, oder es roch nach den Fässern in den Kellern, der Most fermentierte … zu Wein. Alle tranken ihn gerne. Manche verliebten sich sogar in diesen Trunk, tranken und die Familien litten unter deren Trinkliebe. Wir wussten es nicht anders. Wir sind in dieser Umgebung aufgewachsen. Alle klagten über die viele Arbeit mit den Reben und mit dem Wein. A b e r, vielen ging es gut, weil es diesen Wein gab. Die Hektarerträge waren viel höher, als wenn das Dorf andere Pflanzen kultiviert hätte. Das Ausgeizen der Reben war doch wie ein Streicheln der Reben. Fürsorge für die Reben. Wir waren doch so auf die Gesundheit der Reben, ja der Reben, bedacht, dass wir sogar im Lehm bei nassem Boden die Reben spritzten. Quasi als Rebenärzte und Rebenkrankenschwestern. Mit der Buckelspritze, voll mit Medizin, die wog wohl an die 12 – 14 kg, gefüllt, versanken manche so tief im Schlamm, dass man glaubte die Spritzer gingen auf den Knien. Als hätten wir den Reben Antibiotika verabreicht, dass sie den tückischen Rebenkrankheiten widerstanden.
Ja unsere Landsleute, die richtigen nämlich, die dort noch geboren wurden, gehen. Sie kommen nicht wieder. Das mit der Auferstehung gilt doch nicht mehr, denn, würden alle wieder auferstehen, dann gäbe es nur noch Stehplätze. Als die Bibelschreiber die Idee mit der schönen Auferstehung kultivierten, lebten vielleicht 200 Mio. Menschen. Es gab Platz. Und heute leben … so viele Menschen, dass bald die Lebenden nur noch Stehplätze bekommen. Ja, und wenn wir gehen, machen wir Platz. Wir, also die in Marienfeld Geborenen, müssen uns nicht sorgen uns eventuell noch an Stehplätze gewöhnen zu müssen. Und es war doch unerheblich, ob wir zuerst gingen, die Liebhaber dieser Reben, danach die Reben. Es hätte auch umgekehrt sein können. Wären wir vor den Reben ins Ewige gegangen, dann wären die Reben uns gefolgt. Aus Gram, aus Trauer. Wir verließen die Reben, sie verübten keinen Selbstmord, so zähe Reben hatten wir hinterlassen. Man musste den Reben wenig nachhelfen, dass sie gingen. Die mit dem Dorf Beschenkten halfen nach. Die Reben zu tilgen. Für immer. Die Reben und die Marienfelder, und diese untereinander, mochten sich gegenseitig, halfen einander und verstanden sich. Und die gelungene Integration hier in unserer neuen Heimat ist so gelungen, dass wir glücklich darüber sein können. Hätte man das Dorf von dort an einen einzigen Ort, hier in der neuen Heimat, verpflanzt, wäre die Integration Muster für andere Neubürger gewesen. Aber, wir hätten vielleicht ohne Wein und ohne Reben weiterhin einander gemocht. So mühen wir uns über die Erinnerung eine Fernbeziehung aufrecht zu erhalten.
Herzliche Grüße Euch beiden, Erich
Liebe Landsleute, eine Reise durch Ungarn nach Rumänien (März 2023)
Am Sonntag Richtung Österreich-Ungarn-Rumänien zu fahren ist der beste Wochentag, da wg. fehlender LKW auf Straßen der Verkehr nur 50 % eines normalen Wochentags beträgt. Sonst hat man das Gefühl, die Autobahn durch Ungarn müsste nicht 4- sondern 6-spurig sein.
1.
Ungarn Hinfahrt mit einer Übernachtung:
Im Mako (Ost-Ungarn Grenzstadt zu Rumänien) hatten wir wieder das Geburtshaus von Joseph (Joe später in den USA) von außen besichtigt. Ein stattliches 2geschoßiges Haus zentral in der Altstadt Mitte des 19Jh erbaut. J. Pulitzer wurde 1847 in Mako als Sohn eines Getreidehändlers jüdischen Glaubens geboren. Mit seinem Bruder besuchte er gute deutsche Privatschulen in Budapest. Getreidehändler wollte er nicht werden. Soldat schon, es zog ihn in die Armee: In Ungarn fand er keine Aufnahme als Soldat, die französische Fremdenlegion verweigerte ihm die Aufnahme. In Hamburg boten ihm die USA Überfahrt und Einsatz als Soldat in Amerika. Das Soldatenleben endete um 1880 und er arbeitete u. a. als Bestatter, lernte fleißig Englisch. In kurzer Zeit begann er für Zeitungen zu schreiben. Er war als Investigativ-Journalist so tüchtig, dass er Zeitungen aufkaufte und als Verleger zu Ansehen und Vermögen kam. Wichtig, er scheute keine Konflikte mit der höchsten Politik. Seine protestantische Ehefrau gebar ihm ½ Dutzend Kinder. Er starb an Diabetes in 1911. In seinem Testament verfügte er, dass Teile seines Vermögens für Prämien an herausragend recherchierende Journalisten verwendet werden sollen: Der sog. Pulitzer-Preis.
2.
Umweltschutz und Kraftwerke:
In Ungarn sind Windräder zu sehen. Fotovoltaik-Anlagen weniger. In 24 h sahen wir ½ Dutzend Tesla-E-Autos, am grünen Nr.-Schild erkennbar. Dagegen sahen wir in Rumänien an einem Tag nur einen Tesla.
In Rumänien sprach ich mit einem E-Technik-Ing. über das Verbot von Gas- und Ölheizungen in EU und Deutschland. Ob das in Rumänien auch so sei ? Nein, denn ohne Gas und ohne Öl, dann wie heizen ? Ja, mit Holz meinte ich. „La bloc, cum?“ Ich weiter, man könne ja Wärmepumpen einsetzen? Er darauf, ahh ! (pompe de caldura) Wärmepumpen, aber in Rumänien für alle Heizungsanlagen … wer sagt denn das ?
Kohle-Gas-Kraftwerk und Kernkraft: Das Kohlekraftwerk in Mintia neben Deva wurde nach Aufnahme Rumäniens in die EU für rd. 200 Millionen modernisiert, danach stillgelegt und jetzt an einen ausländischen Investor verkauft. Nach einem Umbau von Kohle auf Gas wird eine große Gasleitung zum Kraftwerk gebaut: Kapazität von 170 MWh.
In einer Zeitung wurde berichtet, dass Rumänien die umweltschonende Kernenergie ausbauen werde. Die Kraftwerksblöcke 1 und 2 in Cernavoda wurden modernisiert, Zubauten von Block 3 und 4 und darüber hinaus werden ein Dutzend kleine mobile Kernkraftwerke aus den USA importiert. Fachkräfte werden schon ausgebildet, um ab 2030/31 bis 2000 MA bei der „Nuclearelectrica“ zu beschäftigen. Investsumme in Kerntechnik in Höhe von 12 Milliarden Euro.
3.
Marienfeld im Schnelldurchgang:
Kurzbesuch im Gemeindehaus wg. neuen Geburtsscheins, erledigt in 20 Minuten. Freundlicher Service, Geschenke (dabei gehabt) nicht gegeben, da die Dame sagte, es sei ihr Job, solche Papiere auszustellen. Sie hatte ein altes Register zur Hand, brauchte keine Unterlagen von mir, außer den Antrag, bei dessen Ausfüllen sie mir half, und den Personalausweis.
Viele Häuser aus Stampflehm oder Lehmsteinen vielleicht im 19 Jh. gebaut sind baufällig. Es sind Neu- oder Umbauten und viel Leerstand im Ort zu besichtigen. Auf dem Friedhof: Gräber zerstört, Alters bedingt oder mutwillig, Marmor Denkmäler abgebaut/entwendet (?) und eine Gruft eingestürzt. Aber Bestattungen von Neubürgern bedeuten auch mehr sichtbare Pflege und Achtung der Toten.
4.
Rumänien-Wirtschaft:
Pflege von Kontakten in Cugir, Medias, Resita und Temeswar: Zufrieden sind die Leute mit der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes. Ja, sind mit Zuversicht ! Die Ruinen des Sozialismus verschwinden langsam. In Cugir werden 50 Straßen gleichzeitig neu gestaltet mit Radwegen, Bürgersteigen, Baumneupflanzungen und neuem Asphalt. Ja, das Geld kommt überwiegend aus Brüssel. Die EU wird gelobt, Putin verteufelt. Also pro-ukrainisch: Die Waffen-und Munitionsfabriken haben viele Aufträge wie schon lange nicht mehr. Man wusste zu berichten, dass Rumänen Deutschland verließen, kämen heim oder zögen nach Italien. Manche Geschäftsleute taten so, als sei West-Europa (Brüssel) näher und besser als die Politik im „fernen Bukarest“, die man verachte.
Es gibt in Rumänien steigende Zahlen von Gastarbeitern aus Sri Lanka (Tamilen heißen die), vielleicht auch aus Nepal oder auch aus Pakistan. In Zeitungen war darüber nichts zu lesen. Auf Baustellen des Landes sind die Neubürger Rumäniens zu sehen. Wir fuhren durch den Ort Sarmisegetuza (geographisch hinter Hunedoara) an römischen Ruinen vorbei und sahen auf der Straße einen junger Mann mit langem Bart und einem riesigen bunten Turban auf dem Kopf. Es war Sonntag. In Temeswar sahen wir Bauarbeiter ähnlicher Herkunft in den Straßenbahnen wohl nach Feierabend. Auf einem Rastplatz auf der Autobahn stiegen viele solcher Fremde aus einem Bus.
In der Stadt Cugir sieht man auf Tafeln Anzeigen über laufende Investitionen: In Schulen, Energiesparmaßnahmen u. ä. bei denen jeweils 60 % der Mittel aus Brüssel und 40 % Landesanteile betragen. Das geht dann so: Mit der Gemischtfinanzierung bauen dann Fremdgastarbeiter mit an der Erneuerung der Infrastruktur, wie Straßen, Brücken, Bürgersteige, Leitungen, Kanäle usw. Nach einigen Tagen wird klar, warum kleine und mittlere Firmen in neue Maschinen investieren, größere Flächen anmieten und deren Inhaber größere oder neue Häuser beziehen. Stimmung im Land also: Zuversicht und Optimismus !
5.
Temeswar-Besuch 26./27.03.23:
Die Stadt ist im Zentrum „verhübscht“, insbesondere zwischen Oper und Kathedrale, aber auch der Platz vor der „Primarie Veche“ und „Piata Unirii“. Nicht renovierte Fassaden wurden mit großen Planen verhüllt. Neue 5gliedrige Straßenbahnen aus der Türkei fahren auf Hauptlinien, z. B. zum Nord-Bahnhof und Piata Traian (Fabrikstadt). Die Innenstadt ist voller Menschen und Autos bewegen sich von Stau zu Stau.
Der Eiskugelpreis muss erwähnt werden: 8 Lei je Kugel (rd. 1,65 €). Ein Besuch in der Julius Mol zeigt ein Einkaufszentrum schöner und größer als in Augsburg die Citygalerie. Eine sehr gute Konditorei fanden wir in der 1. Seitenstraße von der Kathedrale kommend rechte Seite Richtung Oper. Die Dobos-Torte dort hatte wohl 15 Blätter. Wir hatten Hotelzimmer im Savoy gebucht, das ist hinter der Kathedrale über der Bega. Auf der Bega verkehren Ausflugschiffe. Hübscher Anblick und erinnert an Italien.
Um all die historisch wichtigen Bauten zu renovieren bedarf es nicht nur Unsummen Geldes, sondern auch handwerklicher Kapazitäten. Da sind Arbeiten für Jahrzehnte nötig. Und Geldüberweisungen aus Brüssel bis die Leitungen glühen.
Begegnung beim Hotelfrühstück mit Eindruck:
Eine ukrainische Familie, Mann ca. 45, Frau ca. 40, 2 Söhne (ca. 15 und 10) mit einem großen SUV-Auto. Der größere Sohn hatte auf dem Rücken seines T-Shirts in Ukrainisch:
„Slava Ukraina“ (Ruhm der Ukraine) - Gruß
„Slava Geroiam“ (Ruhm der Helden) – Antwort Gruß
Nachdenkliche Schlußfolgerungen:
Über Wirtschaft und Wohlfühlen im Lande siehe oben. Optimismus, ja aber. Rumänien hat z. Zt. die größte Verschuldung, die größte Emigration seiner Geschichte in Friedenszeiten, massiver Absturz seines Bildungssystems (max. Schulabbrecherquote) bei international sich überlagernden Krisen: Energie, Umwelt, Krieg in der Nachbarschaft, bei großem Einfluss von Fremdinteressen und vielleicht Vernachlässigung des Eigenen.
Gruß Erich
Am 3. Dezember 2014 veröffentlichte der Agrar-Ingenieur Virgil Grecu einen bemerkenswerten Artikel im Internet. In diesem „beweinte“ er das Verschwinden des nationalen Kulturguts Weingut Marienfeld und stellte der Politik des Landes die Frage nach den Schuldigen. Also die Frage, und diese Frage kam auch von Landsleuten, warum und wer hatte entschieden, mit Weinbau und –herstellung in Marienfeld aufzuhören ?
Nach Beratung mit dem Thema vertrauten und verschiedenen Landsleuten nachfolgend ein Erklärungsversuch, ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
1.
Bei Rückübereignung der Rebenplantagen an die Erben der Voreigner um das Jahr 2000 waren viele Reben bereits 40 Jahre alt. Gemäß dem Gebot, Weinreben nach 20 bis 30 Jahren zu erneuern, wären Neuanpflanzungen nötig gewesen. Diese hätten aber auch zu anderen Anordnungen (Spalier mit vergrößerten Rebenabständen wie schon in kommunistischer Zeit probeweise gepflanzt) und hohen Investitionen für Mechanisierung der Bearbeitung geführt.
2.
Absatzmärkte waren für den markenlosen Marienfelder Wein immer ein Problem. In den ersten zehn Jahren nach dem Umsturz 1989 in Rumänien war der Wein fast unverkäuflich und so billig wie teures Mineralwasser. In der Zwischenkriegszeit verkauften Händler den Wein als zumischenden Wein ins Ausland, zur „Verlängerung von Markenweinen“. Im Kommunismus kümmerte sich der Staat um den Vertrieb (Fructexport). Der Absatz des Weins bei einer Fortführung des Weingeschäfts durch die Erben war unsicher.
3.
Viele Jahrzehnte arbeiteten die Dorfbewohner in der Rebenplantage und Weinherstellung. Mangels alternativer Arbeitsmöglichkeiten plagten sie sich bei geringer Produktivität und nahmen überlange Arbeitszeiten in Kauf. Es gab für jede detaillierte Verrichtung Spezialisten. Die Solidarität und der Zusammenhalt der bei diesen Wertschöpfungen Aktiven war bemerkenswert groß. Nach dem Exodus der Ur-Dorfbewohner Anfang der 90er Jahre konnten oder wollten Verbliebene und Zugezogene diese Arbeiten nicht fortführen.
4.
Im Januar 2007 wurde Rumänien in die EU aufgenommen. Weinexporte und Anlagenimporte für die Rebenpflege und Weinherstellung sowie Arbeitskräftewanderungen wurden liberalisiert. Entscheidend dabei war die Grenzöffnung für die Arbeitsmigration: Hunderttausende Rumänen verließen das Land, zogen u. a. Auslandsjobs den Arbeiten in Weinplantagen und –kellern im Ort vor. Hinweis: Die Bevölkerung Rumäniens nahm zwischen 1989 und 2020 um vier auf 19,5 Millionen ab. Alleine in Deutschland leben heute rund 800.000 rumänische Über die Trommler in Marienfeld
Erinnerungen an die Mokriner Straße der 1950er Jahre
Viele Landsleute glaubten ihre Existenz nur im Ausland begründen zu können und verließen ihre Heimat, in der sich die nationalen Verhältnisse rasant veränderten. Sie wurden in verschiedene Weltgegenden verstreut, aber nicht in alle zugleich, und nicht um an den Ausgangspunkt zurückzukehren. Nach Deutschland zogen sie, waren früher in der Europäischen Union, die seit 2007 auch das Banat Rumäniens umschlungen hält. Die Idee, die Vergangenheit beseitigen zu wollen, ist keine gute. Auch wenn gelegentlich nur ein Anflug von Heimweh bei manchen durchschimmert, ist doch die Frage vernehmlich, wie es denn wäre noch einmal die Mokriner Straße auf- und ablaufen zu können, die nicht mehr sein will, was sie in den 1950ern war.
Die Fotos von Martin Heinrich zeigen die Mokriner Straße im Juni 2021.
Das einzige Paradies, aus dem man nicht vertrieben werden kann, ist angeblich die Erinnerung. Darüber zu schreiben, Jahrzehnte zurück zu denken, offenbart eigene Nöte: Herkunft, Straßen, Schule, Jugend, Familie und Milieu mit Worten für andere zurichten. Es geht um Herkunftsheimat, nicht um Wahlheimat, um die eigentliche unbewegliche Heimat (bleibt wo sie war) mit wechselseitigem Verständnis, Geborgenheit und um eine große Erzählung am anderen Ende eins Lebenslaufs.
Die Trommler sind im Marienfelder Heimatbuch nicht erwähnt. Auch kein Hinweis in dem Buch „Banat“ von Dr. Karl Bell 1926, insbesondere in dem Kapitel „Die Lebensform …“, zu finden. Im Internet gibt es Hinweise auf Trommler im Afrika der Subsahara und „Der Trommler“ im Märchen der Brüder Grimm.
Allerdings können sich Landsleute, heute zwischen 70 und 90, noch gut an die Trommler und deren Wirken im Ort erinnern, sogar an Namen. Gertrud und Helga halfen mit hier eingearbeiteten Erinnerungsdetails. Als Gemeindeangestellte waren die Trommler „Kleinrichter“, also dem „Richter“, Bürgermeister, untergeordnet. Vermutlich gab es im Ort zwei Trommler, die sich das Dorf aufteilten, an jeder Ecke trommelten, Aufmerksamkeit weckten, bis die Dörfler vor ihre Tore traten, dann nach Verstummen der Trommel, Botschaften mit kräftiger Stimme in die Straßen riefen.
Beispiele früher Nachrichtenübermittlung
Trommlerbotschaften: (1) Bis zum 1. Mai müssen alle Stämme der Straßenbäume mit Kalk gestrichen werden, (2) Wegen Schießübungen der Grenzsoldaten ist ab morgen das Sandloch zu meiden, (3) Am Sonntag 9.00 Uhr versammeln sich alle arbeitsfähigen Männer mit Schaufeln und Brotzeit am Gemeindehaus für freiwilligen Arbeitsdienst (Robot) usw. Trommler-Standorte in der Mokriner Straße waren: Die Brücke vor dem Mühlenbrunnen und an den anderen fünf Artesibrunnen bis zum Ende der Mokriner Straße. „Mundfunk“ beförderte die Botschaften von der Hauptstraße zuverlässig an die Bewohner der Seitengassen.
Für die heutige Jungend ist die Nachrichtenübertragung durch Trommler wohl eine dem Mittelalter zuzuordnende, eine Stufe über der Rauchzeichenkommunikation der Indianer. Aber Fahnenschwenken an Flughäfen als Parkanweisungen für Piloten und deren Flugzeuge sind aktuell. Davor gab es das Botenwesen, Läufer oder Reiter überbrachten Botschaften. Nicht zu vergessen, Glockenläuten und Muezzinrufe sind althergebrachte Nachrichtenverbreitungen. Also die Trommlerkommunikation war eine drahtlose, personale und zuverlässige Nachrichtenübertragung ohne Propaganda, sogar ungefährlich für die Verbreiter schlechter Nachrichten.
Den Trommlern folgte die zentralisierte drahtgebundene Lautsprecherpropaganda in die Küchen der Marienfelder. Der analoge Regler für Laut-Leise-Aus-Stellungen war für die Senderwahl ungeeignet, zulässig war nur der vom Hauptempfänger gewählte Sender. Nur Sonntagnachmittag gab es ausnahmsweise stimmungsvolle Schlagermusik eines Wiener Senders. So unzivilisiert die Regimepropaganda daher kam, so unzivilisiert war die Ablehnung unter anderem der Losung: „Niciun petec de pamant ramane ne-insamantat“ (kein Fleckchen Erde ohne Einsaat). Lächerlich ! Am Bahnhof lagen Tonnen Weizen im Regen, sogar für Vieh unbrauchbar, denn Transportkapazitäten fehlten für die reiche Ernte.
Ungewöhnliche Zeiten des Umbruchs
Zu welchen Auswüchsen es Anfang der 1950er kommen konnte, ist an einem unfassbaren Ereignis zu erkennen. An einem späten Sonntagnachmittag im Winter, es war schon dunkel, gingen wir, Edmund und ich, bei heftigem Schneetreiben vom Kino nach Hause in die Mokriner Straße. Auf der Brücke vor der Mühle brannte nur vor dieser eine Lampe. Dort leuchtete Edmund mit seiner Taschenlampe, Dura Fokus, himmelwärts. Wir freuten uns die niedertanzenden Schneeflocken im bewegten Scheinwerferkegel zu sehen. Da kam ein Milizmann mit Fahrer und Pferdewagen Richtung Mühle gefahren und schrie: „Stai !“ Edmund blieb sofort stehen, der Milizionär stieg aus dem Wagen, gab ihm eine Ohrfeige, nahm ihm die Dura Fokus weg und sagte, nachts sei es verboten, den Fliegern Lichtzeichen zu geben. Ich selbst lief weg und wartete bis der weinende Edmund ohne seine geliebte und seltene Taschenlampe ankam.
Und ja, früher machten sich jene mit noch offenen Fragen verdächtig. Hartnäckige machten sich jetzt verdächtig, da sie noch Antworten hatten. Die Politik betrieb eine von oben erzwungene Disziplinierung in großer Inszenierung, mit dem Ziel, der ländlichen Bevölkerung Eigentum, Würde und Autonomie zu nehmen. Es war eine außergewöhnliche Zeit mit unklaren Dingen wie Schwermut, Ängsten, Misstrauen und Unsicherheit. Die neue Ideologie und allgegenwärtige Propaganda ließen ein Defizit an Zukunftsaussichten verspüren.
Mein Opa hatte eine Meinung und Meinungen waren keine ansteckenden Krankheiten. Ihm kam vieles irre und kritikwürdig vor. Nach Enteignungen und Kollektivzwang (in die Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften) tat er sich schwer mit dem Glauben an das Gute im Menschen. Fast nichts funktionierte in dem Arbeiter- und Bauernstaat. Die medizinische Versorgung und die Straßen waren so schlecht, dass sich Gallensteine auf dem Weg zum Bezirkskrankenhaus von selbst lösten, eine Operation erübrigte sich.
Die Mokriner Straße mit einer Länge von über 1000 Metern umfasste mit ihren Seitengassen rund 135 Häuser, die 400 bis 500 Menschen beherbergten. Aber in jenen Kindheitsjahren war der Mittelpunkt dieser nach Westen gerichteten Straße ein kleines Haus. Klein deshalb, weil deren Erbauer später als Amerika-Heimkehrer erhaben zur Straße hin bauen wollten. Dazu kam es nicht. Der 1. Weltkrieg vereitelte die Rückkehr. Das Haus blieb unverändert, quasi die Verschalung eines Teilschicksals, das sich erst in der Fremde entfaltete. Die Mutter blieb ausdauernd bemüht, das Beste zu bieten, damit ihr Sohn in einem vorhersehbar schweren Leben sich werde behaupten können.
Drei Wässer und Brunnen
Im Banater Bergland gibt es einen Stausee mit Namen Drei Wässer (Trei Ape), in den die drei Flüsse Semenic, Gradiste und Brebu münden. Hier beginnt der Lauf des größten Flusses des Banats, der Temesch. Nicht ganz so in Marienfeld. Da gab es zwar auch drei Wässer, aber der Aranka-Kanal hatte mit der Hanufreetz, Roßschwemme und dem Sandloch keine Verbindung. Außer dem Namen keine Gemeinsamkeiten. In der Hanufreetz im Norden sammelte sich Grund- und Regenwasser und diente früher der Bearbeitung des Hanfes. Die Roßschwemme im Osten entstand als Lehm- und Sandgrube, wurde durch Grund- und Abwässer der artesischen Brunnen gespeist. Von „Abschwemmen“, also Waschen der Pferde sommers, kommt der Name Roßschwemme. Das Sandloch im Süd-Westen findet in dem Marienfelder Heimatbuch keine Erwähnung, entstand durch den Aushub von Erdmassen für das Stampfen der Häuser in der Gründerzeit und war Sammelbecken für Grund- und Abwässer der Artesibrunnen.
Für uns Kinder der Mokriner Straße war das Sandloch ein Spielparadies, im Sommer und Winter. Dieser Teich bot Kröten und Fröschen Lebensraum. Enten, Gänse und Hühner hatten im Sandloch Auslauf. Im Winter war dieser Teich zugefroren und zog Schlittschuhläufer an. Dass im Sandloch heute kein Wasser mehr ist hat mit dem Versiegen der Artesibrunnen im Ort zu tun. Das ist aber eine andere Geschichte.
Die Artesibrunnen mit Tiefen über 200 Metern liefen Tag und Nacht, bei Wind und Wetter. Immer ! Wer in der Nähe dieser fünf Brunnen wohnte, brauchte keine Schöpfbrunnen, das Wasser von Artesibrunnen wurde in Kannen oder Eimern nach Hause getragen. Als Kinder spielten wir im Sommer an diesen Brunnen, Baden war jedoch verboten. An diesen Brunnen wurden soziale Kontakte gepflegt und Neuigkeiten ausgetauscht. Diese Artesiwasserversorgung war herausragend und ein Alleinstellungsmerkmal des Ortes.
Artesibrunnen und sorgfältig ausgestaltete Riten, Traditionen, Zusammenhalt, Routinen des Alltags in Verbindung mit Fleiß, erreichter Lebensführung und dem guten Wein bildeten nachhaltige Identität und Stolz der Marienfelder Landsleute.
Über die Roma in Rumänien, im Banat und in Marienfeld
Von Leitner Erich
In fast zwei Jahrzehnten der in Marienfeld verbrachten Kindheit und Jugend gab es stete Kontakte unserer Familie mit lokaler Roma, die auf dem Weg zum und vom Artesibrunnen bei den Großeltern vorbei kamen. Auch liehen sie sich Metzgermesser oder baten gleich Opa um Mithilfe beim Pferdeschlachten. Aber das Fremdartige dieser Hilfsbedürftigen führte oft zu Streit. Und Versöhnung, wenn Mütter mit Kleinkindern auf dem Arm, als Abgesandte des Clans, um Vergebung bettelten.
In jüngster Zeit werden Zigeuner wertschätzend Roma genannt, obwohl sie sich selbst als Zigeuner bezeichnen. Schriftzeugnisse über diese Ethnie sind unter Zigeuner zu finden. Ilie Nastase, der berühmte Tennisstar Rumäniens, bezeichnete sich stolz als Zigeuner. Wegen einiger Roma-Skandale 2008 in Italien sind Rumänen mit der Bezeichnung „Roma“, klingt wie „Roman“, unzufrieden. Führende Roma schlugen deshalb vor, ihre Ethnie „Indirom“ (aus Indien stammend) zu nennen. Schon zu Maria Theresias Zeiten sollten Zigeuner, ihre Integration fördernd, Neubauer (tarani noi) heißen.
Bemühen der Erinnerungen von Marienfeldern
Berufsbedingt führte nachhaltiger Aufenthalt des Verfassers in Ländern Osteuropas zu Begegnungen mit Roma, die in Planwagen fuhren, unterwegs rasteten oder in Restaurants großer Städte musizierten. Dennoch war nicht abzusehen, das Thema, Roma und Marienfeld, zurück ins Bewusstsein zu fördern, mit Ergebnis vorliegenden Artikels. Nach Sammeln umfänglicher Schriftquellen zum „Fahrenden Volk“ in Eurasien, von Indien bis Portugal, fiel die Entscheidung pro Artikel. Nach dieser war klar, weder die subjektive Erinnerung an die Dorfroma, noch Fragmente im Heimatbuch reichten für das Thema. Als Lösung bot sich an, Landsleute um Mitwirken beim „Ausbeuten eigenen Erinnerns“ zu bitten. Mit Erfolg, die Zuschriften enthielten Daten, um die Dorfromafamilie fast vollständig in drei Generationen plausibel zu gliedern (siehe Graphik). Auch Mahnungen enthielten die Beiträge, Sensibles im Artikel zu meiden. Herzlichen Dank für die Unterstützung (in alphabetischer Reihenfolge) an Gertrud, Helga, Manfred, Willi u. a.
Die Roma in der Geschichte Rumäniens
Nicht einmal die Roma selbst hatten genaues Wissen über ihre Herkunft. Erhellendes brachten nicht Historiker, sondern Sprachforscher. Erstmals in 1753 erfasste der Ungare J. Wali die Ähnlichkeiten des Romanes mit dem Prakrit, eine mittelindische Mundart. In 1783 publizierte G. Grellmann in Leipzig eine Arbeit über den Ursprung dieses Volkes: Erkenntnis, deren Sprache ähnelt dem Sanskrit. Manche indische Bräuche und Rituale sind identisch mit denen der Roma. Also begann die Europareise dieser Nomaden, unbekannt warum, in Indien in mehreren Wellen zwischen dem 9. und 14. Jahrhundert: 1. Roma-Migration. Während langer Wanderungen nach Westen verweilte die Roma lange genug u. a. in Persien, Armenien und Griechenland, um Teile der Gastländersprachen zu übernehmen.
In Griechenland werden sie (A)tziganos, Zigeuner im deutschen Sprachraum, aber in jedem Land anders, genannt. Über die Donau nach Alt-Rumänien kamen sie 1385, nach Siebenbürgen 1400 und in die Moldau 1428. Sie folgten als letzte Migranten aus Asien den Mongolen und Tataren. Die Roma konnten als „Freie“ nach Alt-Rumänien und in die Moldau einwandern, ihr sozialer Zustand änderte sich dann in Rechtlosigkeit zwischen Leibeigenschaft und Sklaverei und blieb bis Mitte des 19. Jahrhunderts bestehen. Es gab Unfreie (Sklaven) der Landesherrscher, Großgrundbesitzer und Klöster, Wandernde und solche mit Wohnsitzen am Dorfrand und stets eingeteilt nach handwerklichen Verrichtungen, also Metall-, Holzbearbeiter, Lehmziegelhersteller, Maurer, Goldwäscher, auch Musiker usw. Die für sie Verantwortlichen bemühten sich um Erwerbsarbeit ihrer Unfreien, regelten deren Umherziehen, sorgten für Disziplin, auch durch Züchtigungen, allerdings nicht „auf Leben und Tod“.
M. Kogalniceanu beschrieb in seinem Buch (auf Französisch 1837 in Berlin erschienen), die Einteilung der Roma, siehe oben. Metallbearbeiter der Grundbesitzer lebten besser in festen Unterkünften am Rande von Siedlungen. Die in der Landwirtschaft tätigen Roma wurden schlecht behandelt. Obwohl Kogalniceanus Berichte unvollständig waren, beschrieb er die soziale Verschlechterung der Roma bei Beginn der Mechanisierung ihrer Gewerke. Diese hatten im Mittelalter entsprechend ihrem Können rentable Erwerbstätigkeiten. Das Los der Roma sollte allerdings durch lokale Bindungen (gegen Nomadenleben), Integration, sogar Assimilation, und Bildung verbessert werden.
Die Abschaffung der Unfreiheit in der Moldau 1855 und in Alt-Rumänien 1856 zog sich zwei Dekaden hin, kam jedoch nach zähem Vielfachinteressenausgleich der „Sklavenherren“ zum Abschluss. Die Folge der abgeschafften leibeigenen Sklaverei (dezrobire) der Roma in Rumänien war ab 1859 die 2. Roma-Migration. Sie waren immer ein mobiles Volk, wollten sich nicht als Landarbeiter binden lassen und zogen in Gruppen bis zum 1. Weltkrieg, sogar über mehrere Generationen und Zwischenaufenthalten, nach West-Europa, sogar bis nach Nord- und Süd-Amerika.
In 1918 entstand das vereinte, von der Roma begrüßte, Groß-Rumänien, zu dem das Banat, Bessarabien, die Bukowina und Siebenbürgen gehörten. In den Provinzen lebten die Roma in unterschiedlicher Verteilung: Höchste Konzentration war in Süd- und Ost-Rumänien. In den zwei Zwischenkriegsdekaden verbesserte sich das Leben der Roma. Viele büßten ihre Sprache ein, wurden sesshaft, integrierten sich und gingen in die Schule. Sie blieben dennoch sozial unterste Schicht, insbesondere wegen Technikfortschritts und aufkommender Handwerkskonkurrenz anderer Ethnien. Die Roma wurde als soziale Klasse, nicht als Spezialethnie, trotz 11 % Bevölkerungsanteil (2,5 Mio.), ohne politische Diskriminierung vor der Antonescu-Zeit, behandelt.
Die Staatskrise mit Territorialverlusten im Sommer 1940 brachte General Ion Antonescu an die Macht und er verwirklichte nach deutscher Ideologie seine rassistische Politik. Zu den ersten Opfern gehörten die Roma. Bereits Anfang 1941 erläuterte der zum Marschall aufgestiegene Antonescu seinen Plan, die Roma entweder im Donaudelta oder Baragan anzusiedeln. Deren Leid gipfelte in der Deportation im Herbst 1942: 25000 Roma nach Transnistrien. Über die Hälfte kehrte unvorstellbar verelendet im Frühling 1944 zurück, der Rest fand den Tod durch Hunger, Kälte, Erschöpfung, und Krankheiten. Franz Remmel beschrieb 2003 die Leidensgeschichte der rumänischen Roma in: „Nackte Füße auf steinigen Straßen“.
Nach Rückkehr der Deportierten und Kriegsende war die Roma bei den Wahlen 1946 Gegenstand des werbenden Manifests der Sozialistischen Partei und engagierte sich bei Umsetzung des Sozialismus in der Rumänischen Volksrepublik. Danach verlor das Regime das Interesse an der Roma, verzeichnete diese nicht einmal als Minderheit. Die Roma stellte sich sogar gelegentlich gegen das neue Regime. Während den ersten Revolutionstagen im Dezember 1989 in Temeswar bedrohte die Roma ernsthaft das Kreisinspektorat des Inneren und das 1. Todesopfer der Revolution war ein Rom: Janos Paris erschossen an einer Straßensperre.
Ab 1989, trotz eingeschränkter Reisefreiheit nach Ceausescus Sturz, fand die Roma (Um-)Wege über Polen nach Deutschland einzureisen. Asylberechtigt war sie nicht. Anlass war überwiegend die Flucht aus der Armut. Damit die 3. Roma-Migration. Hunderttausende überforderten deutsche Kommunen. Nach zwei Dekaden erneut eine Roma-Krise: Die die EU dominierenden Westländer besiegelten nach 2007 das die Roma unerwartet benachteiligende Regelwerk im Mitgliedsneuland Rumänien. Durch die Existenz bedrohenden Einschränkungen beim Werken, Sammeln, Handel und Gestalten traditionellen Lebens. Deshalb, jetzt bei gewährter Reisefreiheit, begehrten sie Aufnahme, Leben, Wohnen und soziale Hilfe in den reichen EU-Westländern. Damit die 4. Roma-Migration, in deren Folge mit unlösbaren Dauersozialkonflikten.
Die Roma in der Geschichte Banats
Nach 1718 entschieden die Habsburger eine soziale und institutionelle Modernisierung im Banat: U. a. die Ansiedlung donauschwäbischer Dörfer bei „Beigabe von Zigeunerfamilien“ am Dorfrand. Die Roma lebten abgeschieden, gingen nicht zur Schule, lernten Tugend- und Sündhaftes nur nach Vorleben in der Familie, bekamen zu früh zu viele Kinder, damit ihr Elend verstetigend. Während der Habsburgerzeit, insbesondere Maria Theresias (1740-80) und ihres Sohnes Joseph II (1780-90), regelten wichtige Dekrete durch Ge- und Verbote das Leben der Roma. Das josephinische Gedankengut erfasste alle Roma-Lebensbereiche. Nach dem Tode von Joseph II: Aufgabe dessen Roma-Politik und Rückkehr zum jahrhundertealten Roma-Leben. Die Sozialpolitik der Habsburger während eines halben Jahrhunderts reichte nicht zum Roma-Verzicht auf Nomadenleben und Integration. Allerdings legten die Habsburger die Grundlagen für späteres Leben der Banater Roma, das waren Seßhaftwerden, Sprachassimilierung, Schulbildung, soziale Integration, Religionsübernahme der Mehrheitsbevölkerung, Sammeln, Handel, Landwirtschaft, Gewerbetreiben und für deren Musikleben.
Franz Remmel berichtete 2010 in „Die Fremden aus Indien“ über Roma-Künstler: Ausnahmemusiker Barbu Lautaru, Konzertmusiker Ioan Merchan Nonu aus Nero/Timis und die Romni Rebecca Kovaciu, eine 12jährige Malerin, aus Siria/Arad. Abschließend im Banat nach 1989 auch dieses: In Rekasch und anderen Orten sind heute pagodenhafte Paläste der Roma zu besichtigen, siehe Foto. Die Roma schaffte es auch sich illegal viele historische Gebäude zeitweise in Temeswar anzueignen.
Die Roma in der Geschichte Marienfelds
Früh fragten Vertraute, warum jetzt Gedankenmachen über die Roma? Wäre Vergessen nicht schöpferischer als Erinnern? Nun, es ist die Kultur der Erinnerung, an Fragmente eines Lebens im fernen Marienfeld, an die Mütter, Toten im Friedhof, Trommler, Sozialstrukturen u. a. Es war unser Eigenes, das war so und die Dorf-Roma gehörte mit ihrer zwiespältigen Sehnsucht nach Individualität und Integration in die Gemeinschaft dazu.
Nach der abgeschafften leibeigenen Sklaverei wurden die Roma auf Dörfer verteilt und in 1869 tauchen die ersten 13 Roma in einer Nationalitätenliste des Heimatbuches auf. Bis 1943 waren durchschnittlich 16 Roma im Ort (0,5 % Mitbewohneranteil), damit an 3. Stelle nach Rumänen und Madjaren. Sie wohnten am Dorfrand in 2 Häusern bis zu deren Zerstörung Ende der 1960er Jahre, später in der Geißelgass und im neuen Dorf. Ihre Lebenspartner brachten sie aus Nachbardörfern. Ihre Arbeiten waren nützlich für den Ort, solche, die andere scheuten, wie streunende Hunde einfangen, Müll entsorgen, Beerdigen toter Tiere usw. „Lustig war das Zigeunerleben“ sicher nicht.
Die angepassten katholischen Roma suchten eigennützig wohlhabende Paten für ihre Kinder (Graphik). Leider ist es heute unmöglich die Namen von Mann und Kinder der Boritza, die sie gewiss hatte, heraus zu finden. Als Kinder hatten wir keine Scheu im Umgang mit gleichaltrigen Roma, spielten mit ihnen und Schwabenkinder lernten sogar das Zählen in Romanes (Jek, Dui, Star usw.). Bei der Beerdigung von Hansi im Sommer 1953 war der Verfasser Messdiener mit einem Schulkamerad beim Pfarrer Zens Adam: Trauerzug von Hansis Haus bis in den Friedhof an einem herrlichen Sommertag. Am offenen Grab ihres Vaters kam es zu einem unbeherrschten Gefühlsausbruch der Tochter Boritza. Beim ersten Heimatbesuch des Verfassers mit seiner Mutter Anfang der 1970er Jahre trafen wir zufällig Margit im Ort, die uns voller Wiedersehensfreude herzte.
Die angepasste Dorf-Roma, insbesondere die der 3. Generation, mit weniger Kinder, wurden Landarbeiter in der Staatsferma oder Kollektivwirtschaft, spielten in der Freizeit Fußball oder Geige. Einer wurde sogar Lehrer und unterrichtete im Nachbarort Albrechtsflor. Der Geiger fiedelte später in Nürnbergs Stadtzentrum so „fleißig“, dass Genervte ihm die Geige zerstörten.
Nach über 150 Jahren sind die Roma im Ort integriert oder arbeiten im Ausland wie andere Bürger Rumäniens auch. Über all diese Menschen wurde früher viel Negatives verbreitet, sie wurden verachtet und Distanz zu ihnen wurde gepflegt. Dem Ansehen unseres gemeinsamen Marienfeld haben die ansässigen Roma nicht geschadet.
Abschließend ein Zitat von Pfarrer Kurt Seidner: „Nicht die Hoffnung stirbt zuletzt, zuletzt stirbt das Vorurteil“. Aus „Die Fremden aus Indien“ von Franz Remmel.
Essay: Über die Sozialstrukturen in Marienfeld bis 1944
Von Erich Leitner
Bis zum 2.Weltkrieg gab es auf dem Land im Banat, hier mit Sonderbezug auf Marienfeld, grob drei soziale Klassen, die mit der folgenden Gliederung (fast) alle Gesellschaftsmitglieder umfassten. Bei dem vorliegenden Text handelt es sich um einen Essay, dessen Bezeichnung stammt aus dem Französischen und heißt Versuch, hier einer Erklärung der Herausbildung von Schichten und deren Verstetigung.
Oberschicht
a) Sogenannte Grundherren, also Eigentümer von Agrarflächen und Vieh sowie Betriebsmitteln und Vorratsräumen für Landwirtschaft, Viehzucht, Wein- und Obstbau
b) Geschulte wie Ärzte, Apotheker, Priester, Lehrer und Richter sowie Notare
Mittelschicht
a) Gewerbetreibende (Handwerker) und Fuhrleute
b) Einzelhändler (Kaufleute), Großhändler und Gastwirte
c) Manufaktureninhaber wie Mühlen, Wein- und Obstbrand, Besenfabrik sowie Sodawassererzeugung
Unterschicht
a) Kleinlandwirte, Dauerfremdbeschäftigte wie Arbeitsmänner, Waschfrauen und Taglöhner mit eigenem Wohnraum
b) Knechte und Mägde als Mitbewohner in Nebengebäuden bei Grundherren ohne eigenen Wohnraum
Eine in Schichten aufgeteilte Gesellschaft zeichnet sich durch soziale Ungleichheiten aus und diese werden nicht vererbt wie in feudalen Gesellschaften. Ungleichheit bedeutet ungleiche Einkommens- und Vermögensverteilung. Es handelt sich um funktionale gesellschaftliche Unterschiede zwischen den Schichten. Die Stellung der Einzelpersonen und Familien in der obigen Struktur war durch ihre wirtschaftliche Leistung bestimmt, durch unterschiedliche Qualität der Arbeit, von ungelernter bis zu wissenschaftlich erarbeiteten Techniken, jedoch durch ererbten Besitz, Zufälle und lokale Zwänge relativiert. Die Mitglieder einer sozialen Schicht hatten den gleichen sozialen Status und meistens eine ähnliche wirtschaftliche Lage. Die Schichtstruktur steckte voller Dynamik, auch sozialer Mobilität. Diese sozialen Klassenstrukturen wankten im 2. Weltkrieg und lösten sich nach Ankunft der Roten Armee in Marienfeld am 6. Oktober 1944 in kurzer Zeit auf.
Grundlage für vorliegenden Essay: Heimatbuch Marienfeld
Das Buch der Heimatgemeinschaft, fast 800 Seiten dick aus 1986, gründet auf Arbeiten einer Vielzahl von motiviert und fähigen Mitwirkenden vor 40 Jahren und betraf damals eine Vergangenheit von rund 200 Jahren ab Gründung Marienfelds in 1770. Die Beschreibung beginnt mit dem für Landwirtschaft geeigneten Lößboden und enthält Hinweise warum sich im Ort eine exzellente Weinwirtschaft entwickelte: Miteingewanderte Fertigkeiten für Bearbeitung von Rebenplantagen und Weinerzeugung sowie die wirksame Förderung der Rebenbepflanzungen durch die früheren Grundherren.
Die Autoren konnten das Leben bis in kleinste Atome erzählen und sinnlich erlebbar machen. Es ging immer um Weinbau und um Ereignisse in konzentrischen Kreisen um diesen bei Arbeit und Freizeit im Jahresrhythmus.
Die Geschichtsbeschreibung der Gemeinde besteht auch aus vielen schockartigen Berichten über Rückschläge, Brüchen und Beben, Epidemien, Missernten, Revolutionen, Auswandern, Kriegsausbruch, Frontquerung des Ortes, Flüchten, Enteignungen, Verschleppungen in die UdSSR und in den Baragan. Also Erzählungen über externe schicksalshafte Stürme. Solche wirkten von außen auf den gefühlten in sich geschlossenen Insel ähnlichen Ort, in dem sich ganz eigentümliche Nationalitäts-, Gesellschafts- und Glaubenstraditionen vermischten.
Konflikte zwischen Gerechtigkeit, Gleichheit und realem Leben werden gestreift. Dass der österreichische Kaiser Josef II, nach den gerade durch selbiges Kaiserhaus initiierten Ansiedlungswellen, die Brüder Christoph und Cyrill Nako drängte in 1781 die Banater Güter Groß-St-Nikolaus und Teremi zu kaufen (nur elf Jahre nach Ansiedlung) wird erwähnt und kritisiert wird nicht das, aber die menschenunwürdige Behandlung der Untertanen-Menschen durch Großgrundbesitzer und Obrigkeit bis zu der Revolution 1848. Auch fehlt der Hinweis nicht, dass die Weinhändler ein Kartell bildeten und fast gleiche gedrückte Preise einer Vielzahl von Erzeugern im Ort zahlten. Aber wie und wann sich die sozialen Klassen herausbildeten und verstetigten wird leider nicht thematisiert.
Entstehung und Entwicklung sozialer Klassen
Oberschicht: a) Marienfeld wurde auf ungarischen Kameralgütern angesiedelt. Der Begriff Kameralgut seiner Zeit beschrieb das Eigentum der ungarischen Herrscherfamilie, nicht des ungarischen Staates, das auf den Regierungsnachfolger überging. Der Ort wurde 1769/70 mit 113 ganzen (Hausgrund, 24 Joch Äcker und sechs Joch Wiesen) und zehn halben (Hausgrund, zwölf Joch Äcker und vier Joch Wiesen) Sessionen besiedelt. Es bestand Zehent- und Robotpflicht, d. h. Pflichten Steuern zu zahlen und kostenlose Leistungen für die Herrschaft zu erbringen.
Da viele Ansiedler mit der Bewirtschaftung wegen fehlender Arbeitskräfte überfordert waren und ihren Besitz verließen, besiedelten die neuen Eigentümer der Nako-Familie den Ort zusätzlich bereits ein Jahr nach Erwerb des Gutes Teremi in 1782 mit 44 Kleinhäuslern mit: Hausgrund, je 1 ½ Joch Kleegarten und Hutweide, dazu 1 ½ Joch Weingarten. Unschwer zu erkennen, dass die 44 Kleinhäusler Arbeitskräfte für die Bearbeitung der 113 plus zehn Sessionen darstellten. Das bedeutet, schon eine Dekade nach Ortsgründung gab es Klassen unter den 167 (113 + 10 + 44) Ansiedlern.
Ein Sessionsteilungsverbot bestand bis 1848, gleichbedeutend mit Verkaufsverbot von Teilen der Session. Die Weitergabe der ganzen Session war allgemein geregelt: Der älteste Sohn erbte die ganze Session, allerdings mit Verpflichtungen: Robotleistungen gegenüber der Herrschaft, Bargeldabfindungen an die Geschwister und dauerhaft für die Eltern zu sorgen.
Ab 1849 war es möglich die Session unter den Kindern aufzuteilen, mit dem Ergebnis viele Kleinbetriebe. Andererseits bot sich den Tüchtigen die Möglichkeit, den Betrieb durch Zukauf zu vergrößern. Zugekauft wurde innerhalb und außerhalb der Gemarkung Marienfeld. Eine Option bot die „Herrschaft“ durch Gewähren einer Langzeitpacht. Der unterschiedliche Besitz von Äckern, damals in Joch gemessen, ging einher mit mehr oder weniger Chancen in der Klassengesellschaft. Der Einsatz von Pferden als Zugtiere (Kühe und Ochsen waren im Ort verpönt) und manuelle Arbeit bot in den ersten 100 Jahren ab Gründung kaum Möglichkeiten der Differenzierung unterschiedlicher Produktivität wie später bei der Mechanisierung der Landwirtschaft.
b) Zu der Oberschicht gehörten auch die Geschulten, eine Frühform späterer Intelligenz, die im Dorf vertreten waren. Ab Ansiedlung wirkten „Chirurgen“, Ärzte, Heilpraktiker und Hebammen, ansässig oder von außen kommend. Die selbständige Pfarrei begann in 1770, Ortsrichter und Notare wirkten von Anbeginn in der Gemeinde. Eine Schule wurde alsbald gegründet und der Lehrer wohnte zur Untermiete, wie berichtet wurde. Tierärzte praktizierten ab Mitte, die erste Apotheke wurde Ende des 19. Jahrhunderts eröffnet.
Der Aufstieg der Geschulten zu Priestern und deren Theologiestudien, auch aus der Unterschicht, wurde durch die Kirche gefördert. Klassische Studien der damaligen Zeit, wie Jura und Medizin, fernab des Heimatortes, in vielen Fällen sogar in Österreich oder Deutschland, wurden nur Söhnen vermögender Bauern oder anderer Familien der Ober- oder Mittelschicht ermöglicht.
Mittelschicht: a) Beginnend mit dem Zunftwesen widmeten die Verfasser des Heimatbuches den wichtigen Gewerbetreibenden 40 Seiten. Bereits bei Ansiedlung 1770 waren 28 Handwerker unter den Kolonisten, in 1940 bereits 98. Für Handwerksmeister war es eine Möglichkeit aus der Unter- in die Mittelschicht aufzusteigen bzw. als Meistersohn oder -tochter das Verbleiben in der Mittelschicht zu begründen. Doch der Weg dahin verzehrte viel Arbeit und mindestens ein Dutzend Lehr-, Gesellen- und Wanderjahre. Lernen, lehren und zuletzt Lehre mit Taschengeld beanspruchte eine drei- bis fünfjährige Unterweisung in vielfältigen Verrichtungen in Werkstatt und Haushalt der Meister. Für die Aufnahme der Lehrlinge wurden strenge Bedingungen gestellt, für das Erlernen der Fertigkeiten dagegen genügten oft Mindeststandards. So dass Gesellen auch auf Wanderschaft noch viel lernen mussten, um als Meister in der Gemeinde zugelassen zu werden.
Vor der Motorisierung waren Wagen auf Zugtiere, in Marienfeld, Pferde angewiesen. Robuste Versionen waren zweiachsige Leiterwagen, mit denen Fuhrleute die Feldfrüchte der Bauern zu Schiffsladestellen mühevoll transportierten. Bei der Weinlese halfen Fuhrleute die Trauben in Kastenwagen zu den Pressstationen, den Exportwein in Fässern auf umgebauten Doppelbalkenwagen zum Bahnhof Kikinda oder Mokrin und später nach dem Eisenbahnbau 1910 zum Marienfelder Bahnhof zu fahren: Oft Schwerstarbeit für Mensch und Tier auf aufgeweichten Fahrwegen. Diese kernigen gut verdienenden Mittelschichtler verfügten über Pferde, Ställe für diese, Wagenpark für unterschiedliche Produkte und Arbeitskräfte.
b) Die Entwicklung des Handels ist mit der Dorfentwicklung eng verknüpft. Die frühen Selbstversorger kauften nur Petroleum und Salz. Später trafen Angebot und
Nachfrage auf dem Wochenmarkt aufeinander. Im Laufe der Zeit öffneten viele Einzelhändlerläden (für Endverbraucher) im Ort für: Haushaltswaren, Futtermittel, Gewerbebedarf, Bau- und Holz-(Heiz-)Material, Särge usw.
Großhändler als Wiederverkäufer waren im Ort und außerhalb ansässig, kamen während der Hauptsaison des Getreide-, Trauben- oder Weinkaufs selbst oder deren Agenten nach Marienfeld. Getreidehändler waren im Kernland Ungarns ansässig, Weinhändler hatten ihre Standorte im Ort, in Siebenbürgen, Wien oder anderen Zentren des Handels in Europa. Auch unter widrigen Bedingungen, bei Kriegen und Katstrophen, fanden Waren Abnehmer. An dem Wechselspiel von Angebot und Nachfrage verdienten die Händler und sicherten sich ihren Platz in der Gesellschaftsmitte.
Über Gasthäuser berichtet das Heimatbuch auf 1 1/2 Seiten. Es gab nach den Inhabern benannte, das Müllersche, Huniarsche und Miklosche Gasthaus, weitere Gastwirte werden erwähnt. Neben Kirche und Schule boten Gasthäuser Orte für Übernachtung, Zeitvertreib, Vereine, Geschäftsleute und Politiker. Das Müllersche gab es bis 1875, danach wurde das Dörnersche an der Kreuzung Mittelgasse zu Kreuzgasse gebaut, das nach dem 2. Weltkrieg vernachlässigt, in den 1970er Jahren abgetragen und durch einen Wohnblock ersetzt wurde
c) Manufaktureninhaber betrieben Wertschöpfung als Vorstufe industrieller Prozesse. Die zu veredelnden Produkte gediehen auf den Bauernäckern. Im Heimatbuch wird den Mühlen von allen Manufakturen die größte Aufmerksamkeit gewidmet. Die in den 1920er Jahren erbaute Mühle war ein gigantisches Dorfprojekt, technologisch, betriebswirtschaftlich, das zweihöchste Gebäude des Dorfes, auch im Scheitern mit ruinöser Vermögensvernichtung.
Zur Herstellung von alkoholischen Getränken wurden vergorenes Obst und Treber verarbeitet. Dieser Produktionszweig war ursächlich für ein einträgliches Einkommen, auch für den Staat, der 1/3 Steuern von den Verkaufserlösen beanspruchte.
Das Rohmaterial, Besenreisig, wurde im Ort angebaut, die Verarbeitung zu Zimmerbesen mit einfachen Betriebsmitteln war ein gutes Geschäft, mit bis zu 70 beschäftigten Arbeitskräften. Zu erwähnen sind noch die Sodawassermaschinen, bei deren Betrieb es ständig Probleme mit Gasbelieferungen und zu hohen Steuern gab.
Unterschicht: a) Entgegen Großbauern, deren Flächen für Eigenbewirtschaftung zu groß waren, fehlten Kleinlandwirten mit eigenem Wohnraum Nutzflächen. Familien, die über mehr Arbeitskräfte verfügten als die nutzbringende Scholle erforderte, aber mit dieser Scholle die Familien nicht zu ernähren war, mussten zusätzliche Arbeit annehmen.
Arbeitsmänner, zuständig für alle im Jahresrhythmus aufkommenden Verrichtungen, und deren Frauen als Wäscherinnen, arbeiteten bei den Bauern dauerbeschäftigt. Sie wurden teils in Naturalien, teils als Taglohn berechnet, entlohnt. Die Ganzjahresbeschäftigung war ein großer Vorteil, wog aber den kargen Verdienst für überlange Arbeitszeiten nicht auf. Berichtet wurde spitz, dass der abends spät an den Nagel gehängte Hut sich noch morgens beim Aufstehen bewegte. Dennoch, Männer die solche Dauerbeschäftigung nicht fanden suchten als Taglöhner wechselnde diskontinuierliche Beschäftigungen.
b) Knechte schliefen im Stall und Mägde in Kammern der Bauernnebengebäude. Für Knechte gab es Hierarchien von Aufgaben: Der Großknecht war zuständig für die Pferde, der Kleinknecht für die Kühe und Rinder und die Magd für die Kälber, Schweine und Melken der Kühe. Mägde stammten in der Regel aus dem Ort, Knechte dagegen kamen aus Dörfern des Banats oder gar aus Siebenbürgen. Die Magd war für Haus- und Hofarbeiten und Unterstützung der Bäuerin engagiert. Die Bezahlung des Personals bestand aus Bargeld und Arbeitskleidung. Mit solcher Niederstbelohnung war ihr Verbleiben in der Unterschicht verstetigt.1) In guten Häusern lebte die Bauernfamilie mit den Knechten und der Magd wie in einer harmonischen Großfamilie mit gemeinsamen Mahlzeiten zusammen. Es gab auch schlechte Behandlung, zum Beispiel mit gedehnten Arbeitszeiten, der dem Bauer anvertrauten Jugendlichen. Dass Knechte und Mägde heirateten soll vorgekommen sein, aber Bauernkinder fanden nie Partner beim Personal.
Arbeitsteiliges Zusammenwirken und getrenntes Gesellschaftsleben
Die Basis für das fein abgestimmte Zusammenwirken der ausgedehnten Landwirtschaft mit einer Vielzahl Gewerbetreibender war der das Dorf umgebende Boden. Getreide und andere Agrarprodukte wurden erzeugt, aber der Hauptgegenstand aller waren die Anpflanzung und Pflege der Reben und die Weinerzeugung mit –vermarktung.2) Die Arbeitsteilung zwischen Bodenbearbeitung und den Gewerken und allen drei sozialen Schichten funktionierte harmonisch getaktet mit Routine in guter Koordination, wer welche Aufgaben zu erledigen hatte. Jedes soziale Schichtmitglied hatte seinen Fähigkeiten entsprechend einen individuellen Platz, logisch klar eingeschlossen, nicht getrennt, in einem Ganzen, dessen Stärken darin lagen, arbeitsteilig Strukturen und Abläufe stets zu verbessern, aber auch radikal neue Technologien für den Erfolg zu nutzen.
Im Gegensatz zur integrierenden Zusammenarbeit aller entwickelte sich das Gesellschaftsleben schichtenspezifisch drei geteilt. Ab Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts bildeten sich drei gesellschaftliche Gruppierungen mit je eigenen Lokalitäten, auch als Vereine bzw. Kasino organisiert, und überstanden sogar die Wirren des 1. Weltkriegs. Allerdings büßten Vereine ihre gesellschaftliche Trennschärfe durch Änderungen im Vereinswesen ein. Das Müller-/Dörnersche Wirtshaus stand für Tanz und Unterhaltung der Unterschicht zur Verfügung. Den Jugendverein (erbaut 1911) besuchten die Mittelschichtler, hauptsächlich Söhne und Töchter der Kleinbauern und Gewerbeinhaber, und deren Eltern bei Unterhaltungen, Bällen und Singspielen. Später war das Sängerheim (erbaut 1936) für diese soziale Gruppierung zuständig.
Das Kasino wurde 1885 gegründet und hatte, auch Standort bezogen, eine wechselvolle Geschichte bis zum 2.Weltkrig. Es war Versammlungsort der wohlhabenden Bürger und Ortsintelligenz, also nur der Oberschicht-Vereinsmitglieder. Söhne und Töchter der reichen Bauern waren erstklassig gekleidet und vergnügten sich bei Tanz und Unterhaltung. Die Väter dieser Kinder kamen zusammen, um über die Kommunal- und Weltpolitik, ihr Lieblingsthema Weinbau, ungestört von anderen Schichtbürgern zu diskutieren. Sie hatten Zeit und Muße, um Bücher und dort ausgelegte Zeitungen und Zeitschriften zu lesen. Sie vergnügten sich mit Karten- und Hasardspielen, manchmal Nächte lang und ganze Vermögen riskierend.
Die Verwehrung des Zutritts von anderen Schichten zugehörigen Personen war eine Diskriminierung. Allerdings konnte das Kasino den Zutritt auf Vereinsmitglieder und die Mitgliedschaft durch hohe Vereinsbeiträge beschränken. Über diese soziale Ungleichbehandlung im Kasinobetrieb sind nach über 80 Jahren keine Details mehr bekannt.
Wichtiger war die Wirkung der netzwerkenden Kasino-Mitglieder und darüber schweigt das Heimatbuch. Die Vereinsmitglieder entstammten einer homogenen überschaubaren Gruppe (Gemeindeoberschicht), kannten und vertrauten einander und tauschen wohl Informationen oder gar Leistungen miteinander. Sie bildeten damit ein Kartell, um Preise und Vergütungen in der Gemeinde abzusprechen. Wirtschaftliche Schwierigkeiten, Zwangsverkäufe, Agrarlandangebote und andere Ortsereignisse waren sicher Themen. Damit hatte der Oberstock eine große Bedeutung für die Vermögenspolitik seiner Mitglieder und für die Kommune.
Mobilität und Mehrung der (Oberschicht-)Vermögen
Die Ehrgeizigen verfolgten, bewusst oder unbewusst, Strategien des Vermögenswachstums wie: (1) Quantitativ, (2) Qualitativ, (3) Produktivität und Sparen sowie (4) Familienpolitik.
Zu (1) Nutzflächen Pachten und/oder Zukaufen. Die Enge der Ortsgemarkung führte auch zum Kauf von Grund in Mokrin und Kikinda. Allerdings gingen diese Flächen nach der Grenzziehung 1919 verloren. Zu (2) Die Umwandlung von Wiesen in Äcker und Äcker in Rebenplantagen ließen höhere Jocherträge erwarten. Zu (3) Rationale Bewirtschaftung und Sparen bei Entlohnung der Arbeitskräfte förderten Erträge, aber das Sparen vergrößerte die Sozialprobleme. Zu (4) Die Wohlhabenden begeisterten sich weniger am Kinderreichtum, da dieser dem Vermögenserhalt abträglich war. Die Vielkindfamilien mehrten Armut und vertieften die soziale Kluft. Aus Gründen wie nachfolgend vermerkt ehelichten Männer nur Mädchen aus dem Ort.
Begrenzte Mobilität kombiniert mit dem Stolz der Marienfelder erzwang sozial die Verpaarung der Ortsjungend. Das war auch explizit Thema der anthropologischen Studie der Wiener Universität im Marienfeld der Zwischenkriegszeit. Die Wissenschaftler warnten „… vor den negativen Inzuchtfolgen, damit Grund und Boden beisammenbleiben …“ und empfahlen feinfühlig, dass sich Jungmänner Frauen in den Nachbarorten suchten. Seite 324 Heimatbuch.
1) Zsigmund Moricz in „Der glückliche Mensch“ (Ereignisse um Satu-Mare) und Albert Wass in „Gebt mir meine Berge zurück“ (Ereignisse in Mittel-Siebenbürgen) beschrieben sehr ähnliche Verhältnisse in Ungarn des 19. und 20. Jahrhunderts
2) Virgil Grecu „2014 – anul de deces al podgorie Teremia-Mare”, ein Weinbauingenieur, beschreibt in dem Internet-Artikel vom 3.12.2014 das Ende der Weinkultur und bewundernd den Fleiß, Stolz und Reichtum der Marienfelder mit dem Hinweis, dass manche Weinbauern in der Zwischenkriegszeit jährlich die neuesten Autos kauften.
Über die Toten in Marienfeld
Was einer ist, was einer war, im Tode wird es offenbar
Von Erich Leitner
Jemand sagte, der Mensch könne erst endgültig über sein Leben urteilen, wenn er sein Sterben hinter sich gebracht habe. Aber vielleicht haben Tote kein Interesse an Dingen, die hinter ihnen liegen. Verstorbene werden auf Friedhöfen beerdigt – für eine andere Welt und eine andere Zeit.
In dem 1986 erschienenen „Heimatbuch der Heidegemeinde Marienfeld im Banat“ werden dem Friedhof nur zwei Seiten gewidmet. Die ersten Siedler kamen 1769 im Zuge der theresianischen Kolonisation, im Jahr darauf wurde ein massiver Zustrom verzeichnet und 1771 erreichte die Zuwanderung ihren Höhepunkt. Der Friedhof wurde schon 1771 angelegt und war – wie Kirche, Kapelle, Gemeindehaus, Dreifaltigkeit, Kriegerdenkmal usw. – ein Wahrzeichen des Ortes.
Der Marienfelder Friedhof wurde in mehreren Schritten behutsam bis zum Zweiten Weltkrieg gestaltet, eingezäunt, innen klar gegliedert und aufgefüllt. Damit wurde dem Ruhe- und Komfortbedürfnis der Toten und deren Besucher Rechnung getragen. Doch seit dem Exodus der Nachfahren der Ansiedler Anfang der 1990er Jahre wurde er vernachlässigt. Die Menschen gingen fort und ließen ihre Toten zurück. Seither liegen sie in zum Teil ungepflegten Grabstätten sich selbst überlassen. Sie haben keine Hoffnung auf ein Ende dieses Zustands oder auf Besuch ihrer Angehörigen. Die Verstorbenen liegen still seit ihrem Lebensende da, sie brauchen nichts mehr.
Zur Erinnerung an die Toten in Marienfeld wird über einige anonymisierte Personen, die auf dem dortigen Friedhof begraben liegen, nachfolgend melancholisch, mit beabsichtigter Uneindeutigkeit, erzählt. So entsteht ein Porträt des früheren Marienfeld aus einer ganz anderen Perspektive.
Anna, die Magd
Annas Vater fiel im Ersten Weltkrieg. Sie wuchs bei ihrer aus dem serbischen Banat zugewanderten Mutter auf, die als Wäscherin für einen Großbauern arbeitete. Mit 14 Jahren verdingte sie sich als Magd bei einem anständigen Bauern und half der Bäuerin den Haushalt zu führen. Ständig musste für die dreiköpfige Bauernfamilie, zwei Knechte und ein Arbeitsmann gekocht und gewaschen werden. Anna biss sich in überlangen Tagen durch.
Eine der beiden Kühe ließ sich nicht von ihr melken. Aber der im Stall untergebrachte Knecht half ihr, die Kuh zu bändigen. Für einen Liter heimlich abgezweigter Milch. Kurz vor ihrem 19. Geburtstag lernte sie ihren zukünftigen gleichaltrigen Mann Kristof kennen. Sie fühlten zwar in entgegengesetzter Richtung, heirateten dennoch im selben Jahr.
Kristof, der Schuster
Kristof hatte das Handwerk bei einem anerkannten Meister erlernt, der gute Manieren und Kontakte zu bester Kundschaft pflegte. Allerdings, als die Kinder des Meisters aus dem Haus waren und seine Frau früh starb, begann der von Kristof bewunderte Meister zu trinken. Er verlor stetig Kunden, vertrank seine Existenz und starb schon bald. Kristof verlor seinen Ausbildungsplatz. Die unfertige Lehre verhalf Kristof mit Anna zu einer nur bescheidenen Existenz. Die Ehe blieb kinderlos.
In der Gemeinde führten die beiden Darbenden ein Leben am Rande der Gesellschaft, unauffällig und mit Abstand zu anderen. Umso mehr freuten sich die kurz nacheinander gestorbenen Eheleute, dass sie Zwillingsgräber in bester Mittellage im Friedhof zugeteilt bekamen. Das bedeutete für die Ewigkeit enge Kontakte zueinander und zu anderen, die über der Erde die Nähe zu ihnen gemieden hatten.
Hannes, der Musiker
Hannes war der zweitgeborene Sohn einer Bauernfamilie. Sein Vater hatte früh den beiden Söhnen erklärt, es gebe auf der Welt Wölfe und Schafe. Das eine oder das andere zu sein, sei Schicksal. Der ältere, kräftige Bruder, sozusagen der Wolf, bekam den Hof. Der feingliedrige jüngere Sohn, quasi das Schaf, solle eine Ausbildung machen, legte der Vater fest. Schule und Kaufmannslehre brachte Hannes erfolgreich hinter sich. Parallel dazu eine musikalische Ausbildung: Die Geige war seine große Liebe. Sein Lebensunterhalt und -inhalt waren durch Beruf und Musik gesichert. Auf der Suche nach einer Frau erinnerte er sich an die Worte des Vaters: „Mühe dich nicht, die richtige Frau zu finden, denn die gefundene wird sich als die falsche erweisen. Dann versuche in der falschen Frau genug Richtiges zu finden.“ Er fand eine Frau und bekam Kinder mit ihr.
Hannes konnte durch sein Spiel die Geige und manche seiner Zuhörerinnen zum Weinen bringen. Niemand konnte Chopins Etüde „In mir klingt ein Lied, ein kleines Lied, in dem ein Traum von stiller Liebe blüht, für dich allein“ so hingebungsvoll spielen wie er. Die Reaktion auf diesen Klangstrom offenbarte ihm, es müsse viele „richtige“ Frauen für romantische Stunden geben. Die Freude über diese Erkenntnis wurde früh durch Fingerkrämpfe getrübt: Grenzen des in die Welt gesandten schwermütigen Boten.
Von Melancholie war Hannes stets geprägt. Tief traurig fürchtete er, er könne urplötzlich aus dem Leben rausfallen. Er lebte nicht lange und ruht in der Gruft seiner Eltern. Wer bei Stille an der Gruft vorbeigeht und an Hannes denkt, wird das Summen dieser Melodie „In mir klingt ein Lied, ein kleines Lied … hörst du die Musik, zärtliche Musik“ hören können.
Josef Springer, der Pfarrer
Ausnahmsweise sei hier der Klarname genannt. Von zwei Dutzend Seelsorgern in Marienfeld seit der Ansiedlung war Springer herausragend. Vielen Landsleuten ist er in Erinnerung geblieben, nicht nur wegen seines 20-jährigen seelsorgerischen Wirkens. Auch hinsichtlich seines intellektuellen Potentials. Sein Dienst in der Gemeinde, seine Predigten und Botschaften waren nicht nur die der Freude, auch der Forderung von Opfern und Hingabe. Pfarrer Springer realisierte Ideen, die sein Herz entzündeten. Im Ort fanden sein nützliches Wirken, sein Katechismus-Unterricht und seine Seelsorge Anerkennung in den „Gezeiten“ des dörflichen Rhythmus. Er wurde einer der ihren. Im Leben und im Tod.
Des Pfarrers letzte Predigt, in zwei Steinplatten gemeißelt und an der Friedhofskapelle eingemauert, ist unvergessen. Er fügte den Zehn Geboten weitere zehn spezielle Weisungen der Liebe hinzu. Unter anderem auch die folgende: „Ich habe eure Toten ins Grab gesegnet. Vergesst ihrer nicht.“ Pfarrer Springer konnte nicht ahnen, dass die Adressaten seiner Mahnungen 45 Jahre später den Ort aufgeben und die Toten zurücklassen werden. Auch ihn, eine bemerkenswerte Persönlichkeit.
Ernest, der Alleskönner
Ernest hatte noch zwei jüngere Schwestern. Um die Kinder kümmerten sich die Mutter und die Großeltern. Der Vater war an der Front. Ernest lernte Kriegswirren, keinen Beruf. Im Morgengrauen des 14. Januar 1945 verschleppten ihn grimmige Männer in die Sowjetunion. Ihn, weil die Liste der zu verschleppenden Frauen nicht stimmte. Er musste irgendwo in den geografischen Tiefen des Riesenlandes Häuser, Straßen und Fabriken wiederaufbauen. Nach fast fünf Jahren sah er die Heimat wieder.
Es waren ihm nur eineinhalb Jahre in der Heimat gegönnt, Solidarität, Menschlichkeit und Liebe zu genießen. Es ging wieder los, Menschen niederer Gesinnung verschleppten ihn und seine Familie am 18. Juni 1951 in den Bărăgan. Die Verschleppten waren durch die Partei zu Unzuverlässigen erklärt worden, mussten ihre Häuser auf den Feldern selbst errichten und primitive Landwirtschaft betreiben. Im Januar 1956 wurde allen die Rückkehr in die Heimat erlaubt.
Ein Jahrzehnt seiner besten Jahre hatte Ernest in Verbannung verbracht. In dieser Zeit hatte er vieles gelernt, vor allem Improvisation und Ausdauer. In seiner Heimatgemeinde geschätzt, fand er zu jeder Jahreszeit Arbeit. Er galt als einer der besten im Rebenveredeln. Doch das Schicksal hatte ihn gebrochen. Ernest starb früh und liegt in einer Einzelgrabstätte seitlich des dritten Hauptweges im Friedhof.
Leo, der Schmied
Nach der Gesellenprüfung arbeitete Leo bei seinem Meister. Nicht immer passen physische Anforderungen eines Berufs und Physis des Praktikers zusammen. Bei Leo schon: Der große muskulöse Mann war geschickt und hatte Kraft, mit Esse, Blasebalg, Amboss, Hämmern und Eisen zu arbeiten. Er bearbeitete verschiedene Werkstücke parallel, hatte gleichzeitig mehrere Eisen im Feuer. Später Meister geworden, gründete er seine eigene Schmiede.
Seine Mutter bestellte Vera, eine junge Schneiderin, ins Haus. Diese konnte nicht nur gerade Nähte für Bettzeug, Tischdecken usw. erzeugen, sondern insbesondere Männerhemden. Da Vera über längere Zeit ins Haus kam, kamen sie und Leo sich näher, beim Hemdenprobieren ganz nah. Die jungen Leute brauchten nicht lange, um sich füreinander zu entscheiden.
Sie heirateten und bekamen nur Töchter. Die Schmiede funktionierte, Vera war eine gute Ehefrau. Doch Leo war betrübt, keinen männlichen Nachfolger für die Schmiede zu haben. Berufsbedingte Schwerhörigkeit plagte ihn. Ja, auch das gehört zum Leben. Leo probierte es außerhalb der Ehe und es klappte sogleich. Ein Sohn ward ihm geboren. Bis sich Leo nach Jahren mit dem heranwachsenden „Nachfolger“ in der Schmiede beschäftigen konnte, waren Mutter und Sohn weggezogen. Seine wie auch die Rumpffamilie wurden nicht mehr glücklich. Das Ehepaar starb und ruht in einer würdigen Familiengruft.
Laci, der Fassbinder
Laci lernte sein Handwerk außerhalb des Ortes und kam als Geselle nach Marienfeld. Mit der wachsenden Weinwirtschaft stieg der Bedarf an Fässern. Fassbinder wurden ausgebildet und zogen zu. Weinfässer mit Böden in Kreisform wurden aus Eichenholz gefertigt, bestanden immer aus Dauben, einem Bauch-, Hals- und Kopfreifen. Auf die gewölbte Form der Dauben trieben die Fassbinder Metallreifen.
Laci war talentiert, fleißig und schweigsam. Extravagant war nur sein Schnurbart. Er selbst erzeugte normale und spezielle Hobel, Sägen, Zirkel, Setzhämmer, Hammerstiele, Messwerkzeuge und -schablonen usw. Schleifsteine konnte er zurichten und Werkzeuge scharf schleifen. Kollegen verwandten leichte Hämmer mit langen Stielen oder mittelschwere mit mittleren Stielen. Er hingegen bevorzugte einen schweren Hammer mit kurzem Stiel, konnte rechts- und linkshändig abwechselnd Reifen mit schweren Schlägen schneller als andere treiben, entgegengesetzt dem Uhrzeigersinn oder im Uhrzeigersinn Fässer umrunden.
Nicht ungewöhnlich für den Ort, Laci trank gerne. Da seine Frau Wetti, eine Arbeiterin in den Rebenkulturen, gegen seine Trunksucht stets ankämpfte, traute er sich manchmal erst nachts nach Hause. Laci nervte Wettis Gekreische derart, dass er sich schwor, sich nicht neben ihr beerdigen zu lassen. Aber er verstarb vor seiner Frau und diese wählte später ihre Grabstelle genau neben seiner. Jetzt ruhen beide friedlich nebeneinander. Viel länger schon als die beiden miteinander gestritten haben.
Stefan, der Kellermeister
Stefan, ein stattlicher junger Mann, kam als katholischer Nicht-Schwabe nach 1945 ins Dorf, gründete eine Familie und blieb. Seine Zielstrebigkeit, Herkunft und Parteiarbeit förderten seine Karriere, obwohl er sich Kenntnisse über Reben und Wein erst im Ort aneignen konnte. Als „Sektor-Chef“ fuhr er mit dem Rad durch die „Weinfluren“ und verfolgte die Arbeiten an und mit den Reben. Ob seiner Tüchtigkeit wurde er später zum Kellermeister befördert.
Seine Frau Hilda, eine ausgebildete Schneiderin, bekam eine Stelle als Hilfskindergärtnerin im Kindergarten der „Ferma“. Ja, manchmal wirken Beziehungen, so auch in diesem Fall. Die Kinder der glücklichen Familie studierten beide in Temeswar, der Sohn an der Polytechnischen Hochschule, die Tochter an der Medizinischen Fakultät.
Als Kellermeister verfügte Stefan über ganz andere Ressourcen, um berufliche und private Lösungen zu beeinflussen. Einzig seine Körpergröße war von Nachteil in den niederen Kellergewölben. Irgendwann begann er heftig zu trinken. Ein Leberstreik beförderte ihn überraschend vor seinem 60. Geburtstag auf den Friedhof in die Familiengruft seiner Frau.
Kindheit in der Kriegs- und Nachkriegszeit in Marienfeld
Veröffentlicht in der BP am 05.07.2025
Mein roter Faden der Erinnerung
Von Erich Leitner
Jede Erinnerung bringt die im Inneren abgelagerte Vergangenheit wieder hervor. Um aus den Fragmenten nach einem Dreivierteljahrhundert einen roten Faden zu ziehen, bedarf es großer Anstrengung. Ich möchte hier eine vaterlose Kindheit in der Kriegs- und Kriegsfolgezeit aufzeigen, die sicher anders war als die in einer vollständigen Familie. Für mich gab es nur diese Kindheit, die ich dennoch als eine schöne Kindheit empfinde. Zu schön, um sie mitnehmen zu können.
Krieg und danach im Heidedorf
Kriege sind schrecklich, aber historisch gesehen enden sie doch mit einem längeren Frieden. Nach dem Ersten Weltkrieg dauerte es allerdings nur 20 Jahre, um sich im Zweiten Weltkrieg mit viel größerem Leid fortzusetzen. Im Gegensatz zu früher blieb das Kriegsgeschehen den Augen der Bevölkerung nicht mehr weitgehend entzogen, auch unbeteiligte Zivilisten waren zunehmend betroffen.
Meine beiden Großväter waren im Ersten Weltkrieg Soldaten der Armee Österreich-Ungarns. Als sie heimkehrten, gehörte ihr Heimatdorf zum Königreich Rumänien. Mein Vater absolvierte in der Vorkriegszeit des Zweiten Weltkriegs endlose Wehrübungen, bei Kriegsbeginn rief ihn das Königreich Rumänien zu den Waffen. Als sich die Niederlage Rumäniens abzeichnete, zog man meinen Vater zur Deutschen Wehrmacht ein. Aus dem Königreich Rumänien wurde eine Volksrepublik, aus dem Deutschen Reich wurden besetzte Länder - die Bunderepublik Deutschland und die Deutsche Demokratische Republik - andere Landesteile wurden in andere Staaten eingegliedert. Um nicht für Kriegsniederlagen mit verantwortlich gemacht zu werden, hat unsere Familie nach dem Zweiten Weltkrieg entschieden, dass die männlichen Nachkommen alle Armeen der Welt meiden würden.
Nach Kriegsende überstürzten sich die Ereignisse in Marienfeld. Die Panik war vor allem das Resultat der Furcht vor der Roten Armee und einer gesellschaftlichen Radikaltransformation nach dem Modell der UdSSR mit Verstaatlichung der Produktionsmittel mit einer zentralen Kommandowirtschaft. Ich wurde 1942 geboren. Einige Ereignisse haften mir im Gedächtnis, weil sie in der Familie immer wieder erzählt wurden, andere sind Teil meiner kindlichen Erinnerung.
Rote Armee, Enteignung und Deportationen
Meine Eltern zogen bei Kriegsbeginn 1939 in das Haus in der Mokriner Straße, in dem mein Vater wegen der Wehrübungen, Soldatenpflichten, der Kriegsgefangenschaft und der verwehrten Heimkehr kaum lebte. 1943 war mein Vater letztmalig in Fronturlaub, da war ich eineinviertel Jahre alt. Erst 18 Jahre später sah ich ihn in Bad Reichenhall in Bayern wieder. Da unsere Familie nicht flüchtete, kam im Oktober 1944 ein Sowjetsoldat ans Tor (meine Mutter drückte mich zitternd in ihren Arm) und wollte ein Pferd (Konya). Doch wir hatten keins. Im Januar 1945, wie einige Male vorher, suchte ich in der Nachbarschaft nach den Nuss-Stangen, die dort immer im Wandschrank des Vorhauses zu finden waren, aber jetzt fehlten. Deshalb fragte ich nach der „lieben Zuckerbäckerin“. Ich erfuhr, dass sie kurz zuvor in die Sowjetunion verschleppt worden war. Mutter und Vater der Verschleppten weinten bitterlich.
Ich habe auch vage Erinnerung an die Enteignung: Im Sommer 1948 wurden die Felderträge nicht geerntet. Da schickte mich Oma auf ein nahes Feld Mohnköpfe schneiden. Unvergessen bleibt für mich die Bărăgan-Deportation am Sonntag, dem 17. Juni 1951: Da Mutter und die Großeltern nicht wussten, ob auch die Familie der Schwester meiner Mutter verschleppt wird, lief ich morgens allein von der Mokriner Straße, mit einer Milchkanne als Tarnung in der Hand, durch die Vordergasse zur Tante, wechselte die Straßenseite, wich dem vor einem Hause wachenden Soldaten aus. In der Kikindaer Straße schliefen noch alle, als ich am Schlafzimmerfenster der Tante klopfte. Überraschung und große Freude: Unsere Familie wurde nicht deportiert! Mit dieser Nachricht eilte ich nach Hause. Als Opa Anfang der 1950er Jahre sein Feld unter Zwang in die Kollektivwirtschaft einbringen musste, war er für immer verbittert. Als „Agrarproletarier“ musste er nun wie ein Taglöhner mit der Hacke auf fremde Anweisung Feld bearbeiten. Der Slogan „Ihr werdet nichts haben und glücklich sein“ stimmte damals schon nicht.
Das häusliche Umfeld
In meinem Lebensweg sind die dörfliche Herkunft und das Banat zentrale Pfeiler der Sozialisation. Familie und Gemeinschaft, Religion und Kultur prägten meine Identität, die auch abseits der Heimat fortlebt.
Das häusliche Umfeld und die Tüchtigkeit meiner Familie und Nachbarschaft prägen meine Erinnerung. Vor unserem einfachen Haus gab es einen schönen, durch Buchsbaum gegliederten Rosengarten, in dem meine Mutter die Rosen veredelte. Im Trennzaun zwischen dem Rosengarten und dem Obstvorhof mit Quitten- und Aprikosenbäumen standen zwei Fliederbäume in lila und weiß. An unsere Aprikosenbäume erinnert sich einer meiner Schulkollegen noch nach 70 Jahren. In den Ställen im Tierhof hielten wir Nutztiere: Hühner, Ziegen, Kaninchen und Schweine. Das Tierwohl war kein Thema: Für alle Tiere gab es Plätze in Ställen mit Türen zum jeweils abgegrenzten Auslaufbereich an die frische Luft.
Ganz hinten auf dem Grundstück befand sich ein Kleingarten für Tomaten, Suppengemüse und Kaninchenklee. In diesem Garten überwinterten unsere Kartoffeln frostfrei in einer tiefen Spezialgrube. Im Gartenzaun zwischen Tierhof und Kleingarten standen je ein Apfel- und Birnbaum. Trinkwasser holten wir vom Artesibrunnen am Straßeneck, zum Bewässern nutzten wir Tiefbrunnenwasser.
Der uns von Nachbarn geschenkte Hund Dundi, die zugelaufene Katze Mina und zwei namenlose Wildtauben im Käfig lebten mit uns. Es ist schön, an die Gespräche mit den Tieren zu denken, die ich als Kind führte und bei denen ich mir ihre Antworten ausdenken musste.
Gemeinschaft im dörflichen Umfeld
Ab dem Kindergartenalter wurde mein Radius größer, er reichte jetzt bis in die Klosterschule, wo ich die Kindergarten- und Schulzeit verbrachte. Die Jausenbrote waren in eine bunte Blechdose gepackt. Ich erinnere mich aber an eine gewisse Einförmigkeit im Kindergarten, die Rutsche durfte nur selten genutzt werden. Doch es gab keine andere Möglichkeit, denn meine Mutter musste arbeiten. Rund zehn Jahre lang war der Weg zur Klosterschule meine tägliche Pflicht, während der Schulzeit manchmal noch nachmittags. Die Schule machte mir Freude. Mein Schulranzen bestand aus filigranem Holz. Schiefertafel und Schwamm waren darin – sinnvolle Arbeitsmittel, die jedoch beim Laufen Lärm machten. Im Rückblick war die Schule sehr gut für meinen weiteren Lebensweg. Anlässlich eines Besuchs in Marienfeld lobte ich meine Schulzeit und meine Lehrer bei einem Lehrertreffen.
Obwohl das Regime Kirchgänge behinderte, waren Katechismus-Unterricht und Messdienen möglich. In Erinnerung geblieben ist mir das Anzünden des Weihrauchkessels auf der Außentreppe der Sakristei. Da die Oma eines Schulkollegen Mesnerin war, durften wir oft die drei Glocken läuten und uns an deren Seilen die Bubenhände heiß reiben. Gleich daneben stand die mächtige Kirchturmuhr, in deren Nähe fühlte man das Zittern des Glockenturms unter den Schlägen des Stundenhammers.
Zusammen mit dem Nachbarfreund erkundete ich am Bahnhof die Waggons und deren Bremsen, die Schienen, Weichen und den tickernden Morseapparat. Wir fanden heraus, dass die Radform das Entgleisen verhinderte. Den Weichenwart Motica beobachteten wir beim Weichenstellen. Bei nahenden Zügen legten wir das Ohr auf die Schienen und verglichen, wann wir das Geräusch jeweils in der Schiene und in der Luft hörten. Wir erkannten den Unterschied, denn die Fortpflanzung des Schalls im Stahl ist um mehr als das Zehnfache schneller als in der Luft. Fasziniert waren wir vom Morseapparat für die Übermittlung von Schriftzeichen: Punkt (.) Strich (_) und Pause ( ). In der ersten Szene des Films „Spiel mir das Lied vom Tod“ mit Charles Bronson erinnerte mich der Morseapparat an meine Kindheit.
Die Menschen fühlten sich in der Gemeinschaft verbunden und solidarisch. Selbstverständlich half jeder jedem: Arme wurden unterstützt, körperlich Eingeschränkten Arbeit vermittelt, Werkzeuge an die verliehen, die sie gerade brauchten (z. B. der Fleischwolf für Schweineschlachten). Wer etwas Bestimmtes konnte (z. B. Veredelmesser schärfen), half den weniger Begabten. Für Hilfe gab es keine Begründung und keine Verpflichtung zur Gegenleistung.
Weil jeder die Augen offenhatte, gab es in Marienfeld viele aufmerksame Schutzengel. Bei Beginn der Kindergartenzeit kam ich einmal heim und erschrak, denn meine Mutter war nicht da. Ich weinte laut vor dem Tor. Da kam Hilfe von einem Schutzengel: Gegenüber auf der Bank saß Hunyar-Oma, die mich tröstete und rief: „Geh zur Großmutter, die wartet auf dich.“
Durch das Sandloch (die von Artesibrunnen gespeiste frühere Baustoffgrube wurde zum naturbelassenen Teich) lief ich ungezählte Male. Tag für Tag ging ich mehrmals denselben Weg, den niemand pflegte, vorbei an Maier Jakob, Fassl, Eberle und weiter, überquerte die Straße, lief eng am Nordufer des Teichs hinter Niculescus Zaun vorbei zur Oma, die immer daheim war. Ich kannte jeden Baum, jedes Unkraut und jeden Müll am Wegrand. Zwischen Niculescu und dem Großelternhaus stand eine schöne Pappel, der später Blitz und Sturm zusetzten. Einmal sah ich, wie eine Kröte mit der Klapperzunge ein Insekt wegfing. Manchmal flogen flinke Schwalben über den Teich. Wenn die kurzen Schnäbel knappten, bedeutete das jedes Mal den Tod eines Insekts. Den Sonnenuntergang über dem Sandloch genoss Oma, wenn sie im Sommer vor ihrem Haus saß. Ich mochte sie sehr und gönnte ihr die Entspannung. Sie brauchte keine Uhr, erkannte die Tageszeit am wandernden Schatten.
Das Sandloch änderte mit den Jahreszeiten sein Gesicht: Dem freudig ergrünenden Frühjahr folgte ein wunderschöner warmer Sommer, dann das gelassene Sterben des Herbstes nach Einbringen der Ernte bis zum ungemütlichen Winter mit Sturm und Kälte. Aber auch Frost und Eis bescherten Kindern schöne Stunden auf Schlittschuhen. Heute steht kein Wasser in der Senke, denn der sie früher speisende Artesibrunnen ist längst versiegt.
Erich Leitner durfte mit seiner Mutter im Sommer 1961 mit Hilfe des Roten Kreuzes ausreisen. Er gehörte damit zu den Nutznießern des Abkommens zur „Familienzusammenführung“ nach dem Tod Stalins 1953 und dem Ungarnaufstand 1956. Für die Abwicklung war die Französische Botschaft in Bukarest zuständig, denn zur Bundesrepublik Deutschland gab es noch keine diplomatischen Beziehungen. Bis zum Erfolg des Antrags dauerte es sechs Jahre, zweimal war er abgelehnt worden. Erich Leitner erinnert sich noch an eine Handvoll weitere Fälle in seiner näheren Umgebung, die aufgrund dieses Abkommens zu ihren abwesenden Familienvätern ausreisen durften: In die Bundesrepublik Deutschland und USA, nach Argentinien und Australien.